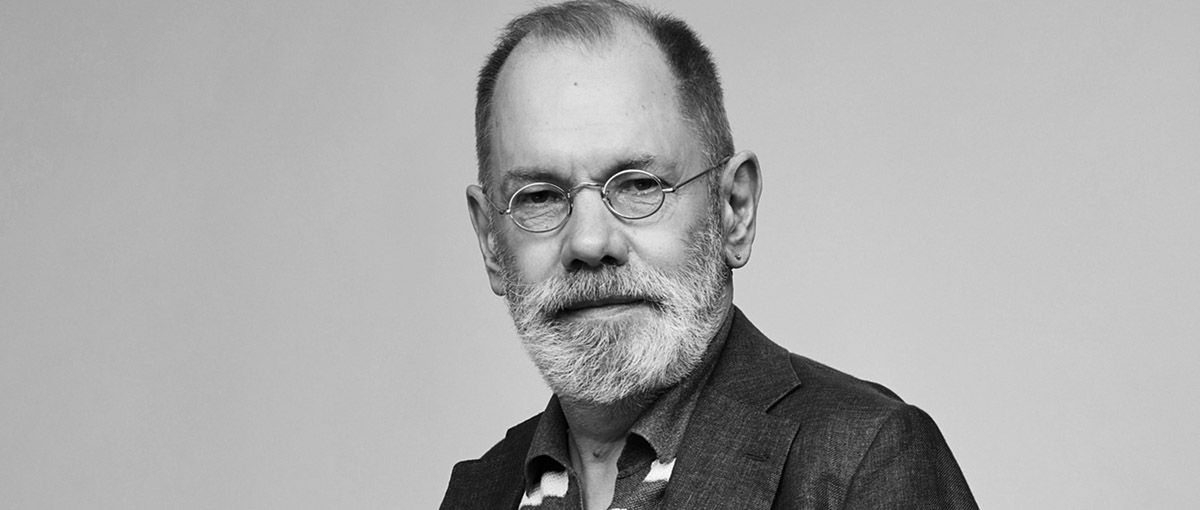Herr Weyrauch, "buten un binnen" war im vergangenen Jahr das erfolgreichste Regionalmagazin. Wie erreicht man eigentlich jeden Abend einen Marktanteil von 40 Prozent?
Der Erfolg hat sicher mit Corona und einem daraus resultierenden Informationsbedürfnis zu tun. Die ersten hohen Ausschläge mit 40 oder 50 Prozent hatten wir schon während des ersten Lockdowns – und seither haben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz offensichtlich daran gewöhnt, sich ihre regionalen Informationen täglich bei uns zu holen. Dazu kommt, dass wir "buten un binnen" längst nicht mehr allein als reines Fernsehmagazin betrachten, sondern als regionale Informationsmarke, die auch online und im Radio stattfindet. Unsere Website wird immer relevanter und die im März gelaunchte App macht inzwischen den Großteil unseres Online-Traffics aus. Und auch das Radio trägt erheblich zu der Entwicklung bei. Bei allen regionalen Informationen auf unseren Wellen verweisen wir auf unsere "buten un binnen"-Regionalredaktion. All das schärft die Marke und hilft letztendlich auch dem klassischen Fernsehmagazin.
Wie zeitgemäß ist ein solches Regionalmagazin überhaupt?
"buten un binnen" war ja das erste Regionalmagazin der ARD. Im Laufe der Jahre hat sich die Sendung immer weiterentwickelt und trotzdem ihren alten Charme beibehalten. Einerseits lebt "buten un binnen" von herausragendem regionalen Journalismus, der stets nach einem besonderen Dreh in den Geschichten sucht, aber auch von der Nähe zum Publikum – auch räumlich. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren sowie Reporterinnen und Reporter leben hier, man sieht sie in der Straßenbahn. Auf der anderen Seite schalten uns viele ein, weil sie sehen wollen, ob sie jemanden kennen. Nicht umsonst starten wir immer mit einem Menschen aus der Region, der am Anfang jeder Sendung "buten un binnen" in die Kamera sagt. Da profitieren wir in besonderem Maße von unserem kompakten Sendegebiet. Ein klarer Vorteil gegenüber anderen Magazinen, die deutlich größere Regionen abbilden müssen. Also Relevanz, Nähe, guter Journalismus – ich finde, das ist sehr zeitgemäß.
Aber lassen sich damit auch jüngere Menschen begeistern?
Wir erreichen mit der Fernsehsendung natürlich sehr viel mehr ältere Menschen, aber zu unserem eigenen Erstaunen haben wir auch bei den Jüngeren gewonnen. Mit einem Marktanteil von 34,6 Prozent sind wir beispielsweise bei der mittleren Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen besonders stark. Und selbst bei ganz Jungen, den hart umkämpften 14- bis 29-Jährigen, von denen wir wissen, dass sie immer weniger klassisches Fernsehen gucken, verbuchen wir einen Marktanteil von 11,1 Prozent. Klar ist aber auch, dass wir diese Gruppe eher mit unseren Angeboten im Radio und Netz erreichen.
Radio Bremen ist in den vergangenen Jahren ja immer wieder damit aufgefallen, innovative Projekte für jüngere Menschen zu starten. Wie einfach lässt sich das aus einem kleinen Haus wie Radio Bremen heraus bewerkstelligen?
Wir sind bei Radio Bremen sehr gut im Netzwerken, weil wir viele Ideen nicht dauerhaft aus eigener Kraft umsetzen können. Wenn sich also eine Idee als gut erwiesen hat, müssen wir nach Partnern suchen. So wie beim "Y-Kollektiv", einem jungen Reportage-Format, das wir für funk produzieren. Von Beginn an kooperieren wir hier mit der funk-Zentrale in Mainz. Seit einigen Jahren gibt es mit "Rabiat" ein Spin-Off, das wir eigentlich für den Montags-Sendeplatz im Ersten gedacht haben. Nun wollen wir dieses Format speziell für die ARD Mediathek weiterentwickeln, um mehr jüngere Menschen auf unsere ARD-Plattform aufmerksam zu machen. Glücklicherweise hat der SWR zugesagt, mit uns gemeinsam "Rabiat" in diese Richtung weiterzuentwickeln, sodass es uns hoffentlich gelingen wird, zukünftig ca. einen "Rabiat"-Film pro Monat für die ARD Mediathek herzustellen. Das gleiche machen wir für die ARD-Audiothek, für die wir ein weiteres Spin-Off, den "Y-Kollektiv“-Podcast, geschaffen haben. Auch hier kooperieren wir mit einem größeren Haus, in diesem Fall mit dem MDR. Auf diese Weise schaffen wir – wie bei "buten un binnen" – Marken, die über alle Ausspielwege funktionieren. Und von den Erfolgen profitieren dann alle beteiligten Häuser und natürlich unser Publikum.
 © Radio Bremen
Künftig soll zusammen mit dem SWR etwa ein "Rabiat"-Film pro Monat für die ARD-Mediathek entstehen.
© Radio Bremen
Künftig soll zusammen mit dem SWR etwa ein "Rabiat"-Film pro Monat für die ARD-Mediathek entstehen.
Liegt das Ziel also letztlich darin, sich auf einige wenige starke Marken zu konzentrieren?
Für uns ist das jedenfalls der beste Weg, den wir gehen können. Wir können nicht alles machen und konzentrieren uns daher auf Genres, in denen wir stark sind. In der digitalen Welt, in der der Platz unendlich ist, ist es umso wichtiger, klare Marken oder Labels zu etablieren und sukzessive auszubauen – auch mit neuen Ideen rund um diese Inhalte. Denken Sie beispielsweise an "How to Tatort". Unser neues "Tatort"-Ermittler-Team haben wir eingeführt, indem wir exklusiv für die ARD Mediathek ein Prequel als Mini-Serie produziert haben, in dem sich unser neues Team selbst auf die Schippe nimmt. Das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt schon darüber nachdenken, eine Nachfolge zu produzieren. Allerdings ist das natürlich für uns auch immer eine Geldfrage.
Wie sehr müssen Sie haushalten?
Im Videobereich können wir nicht fünf Ideen gleichzeitig probieren, sondern müssen uns auf eine konzentrieren und hoffen, dass sie funktioniert. Audio zu produzieren ist erheblich günstiger, dadurch haben wir als kleines Haus hier etwas Spielraum, einmal mehrere Ideen parallel auszuprobieren. Aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr 500.000 Euro in die Hand genommen, um intern eine Podcast-Initiative für die besten neuen Ideen zu starten. Auf diese Weise ist etwa der "Y-Kollektiv"-Podcast entstanden, aber auch ein Werder-Podcast oder "Shop your Baby", eine Reihe, in der unsere Reporterin auf sehr persönliche Weise über verschiedene Wege berichtet, wie man schwanger werden kann, wenn es auf natürliche Weise nicht klappt. Mit "Kein Mucks!", einer Reihe, in der wir zusammen mit Bastian Pastewka Krimi-Hörspiele aus den 60ern und 70ern aus unseren Archiven ausgraben, ist uns im vergangenen Jahr ein echter Überraschungserfolg gelungen. Die Reihe ist in der ARD-Audiothek so erfolgreich, dass wir auch hier künftig mit anderen ARD-Anstalten kooperieren, die dann ihrerseits ihre Archive für "Kein Mucks!" öffnen werden.
Vor welchen Herausforderungen steht Radio Bremen in den kommenden Jahren?
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hat uns für die nächsten Jahre bis 2024 Planungssicherheit gegeben. Das heißt nicht, dass wir im Geld schwimmen, aber wir können bei entsprechenden jährlichen Sparanstrengungen fast im Status Quo weiterarbeiten und sind dadurch in der Lage, Geld vom Linearen ins Digitale umzuschichten. Das ist im Übrigen nicht nur notwendig, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, denn auch die Generationen Ü50 und Ü60 wandern zunehmend ins Digitale. Auf diese Entwicklung muss nicht nur Radio Bremen, sondern die ARD als Ganzes reagieren.
Was ist mit Blick auf Radio Bremen heute anders als vor zehn Jahren, als Sie als Programmdirektor begonnen haben?
Wir haben es in zehn Jahren geschafft, uns ein klares Image zu erarbeiten. Jeder weiß, wofür wir stehen – nämlich für innovative Programmideen. Das macht es einfacher, Verbündete zu finden. Die großen Erfolge der Zukunft werden wir nur schaffen, wenn wir mit anderen Landesrundfunkanstalten gemeinsam arbeiten. Dazu passt, dass wir gerade eine Initiative für serielle Audio-Produktionen gegründet haben, die im Frühjahr mit "Lost in Neulich" das erste Produkt hervorbringen wird – eine Weekly exklusiv für die ARD-Audiothek. So etwas würden wir alleine nicht hinkriegen. Inzwischen sind schon vier ARD Anstalten dabei, weitere haben Interesse angemeldet.
Sie kommen aus Berlin, waren lange in Hessen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie Bremen für sich persönlich verstanden und verinnerlicht haben?
Wir Berliner sind ja, was die Bewertung anderer Städte angeht, ein wenig arrogant. Ganz wenige Berliner verlassen überhaupt je ihre Stadt. Als ich nach Frankfurt kam, habe ich eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, wie die Stadt tickt. Der Zugang war nicht ganz einfach, was auch daran liegen mag, dass viele dort Zugereiste sind und zum Arbeiten hinkommen. Aber nach einem Jahr etwa habe ich mich dann da sehr wohlgefühlt und wollte eigentlich auch gar nicht weg. Bremen wiederum erinnert mich ein wenig an Berlin, jedenfalls sind die Bremerinnen und Bremer mindestens genauso stolz auf ihre Stadt wie die Berliner. Das finde ich sehr sympathisch. Wer hier in Bremen geboren ist und einmal weggeht, kommt irgendwann wieder. Dieses Lebensgefühl hat mich regelrecht mitgezogen. Vielleicht ein gutes Bespiel: Ich war mal Hertha-Fan, aber es hat hier keine zwei Monate gedauert, bis ich angefangen habe, mich für Werder zu interessieren. Inzwischen brenne ich für Werder, selbst wenn sie – wie bis vor wenigen Wochen – grottenschlecht spielen. (lacht)
Herr Weyrauch, vielen Dank für das Gespräch.



 von
von