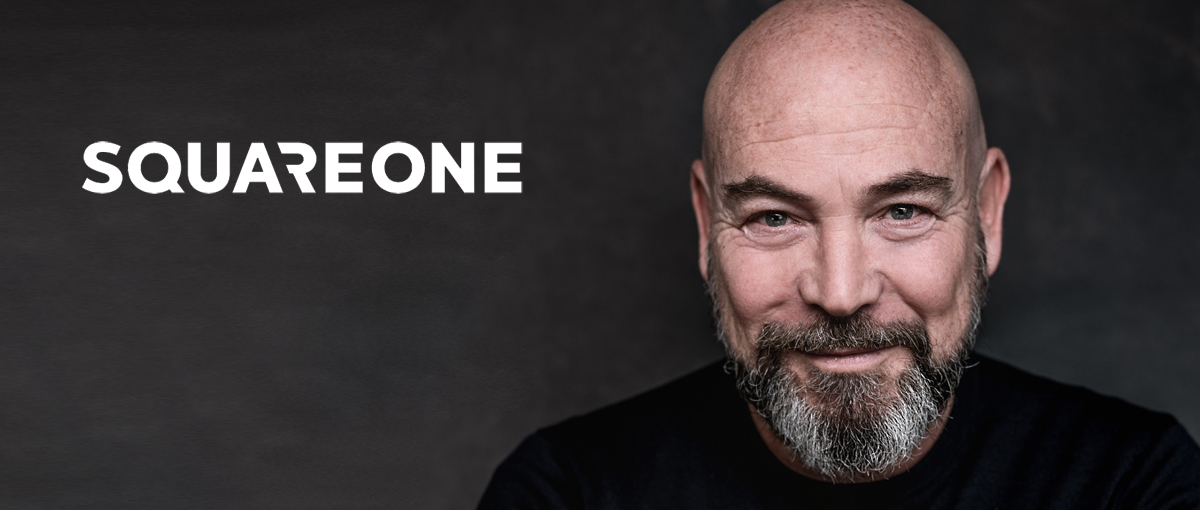Sprechen wir über die Gefahren, die von „House Of Cards“ ausgehen. Sprechen wir von Entdeckung, Aufklärung und Sucht. Sprechen wir davon, wie alt deutsche Filme und Serien aussehen, wenn man sie neben diese Serie hält. Ehrlich gesagt, sie haben nicht den Hauch einer Chance. Da könnten sich die Spitzenkräfte des deutschen Fernsehschaffens noch so sehr anstrengen, das Verführungs-Niveau von „House Of Cards“ werden sie niemals erreichen.
Nun bin ich keiner dieser Ich-schaue-nur-noch-US-Serien-auf-DVD-Angeber. Ich mag es, wenn das Fernsehen meine Woche strukturiert, wenn ich nicht dauernd selbst entscheiden muss, was ich sehen will. Aus demselben Grund hasse ich Salatbüffets. Ich habe keine Lust, mir den Grünkram selbst zusammenzusuchen. Dafür gibt es Fachkräfte, die gelernt haben, was wozu passt. Ich operiere mich ja auch nicht selber.
Wer sich aufs lineare Fernsehen verlässt, ist manchmal natürlich auch ein bisschen verlassen. Er muss schauen, was im aktuellen Angebot ist. Für den Notfall habe ich dann immer noch ein bisschen was auf der Festplatte gebunkert. Also für den Fall, dass mir etwa das Erzähltempo bei „Breaking Bad“ ein wenig lahm erscheint; für den Fall, dass mir die 178. Wendung im Paranoia-Panorama von „Homeland“ gewaltig auf die Nüsse geht; für den Fall, dass ich „Mad Men“ jenseits der Ausstattungskunst einfach nur noch langweilig finde. Wie oft ist mir schon die beste Serie der Welt angedient worden, und wie oft habe ich nach Ansicht des Gepriesenen gierig nach den Drogen gefragt, die zu solch abstrusem Urteil führten.
„House Of Cards“ hat all diese frühtelevisionären Schädigungen geheilt. „House Of Cards“ hat mich verführt, gefangen, gefesselt. Oh ha, dachte ich. Jetzt bin ich auch einer von denen, die nicht abwarten können, bis die nächste Folge läuft. Angefixt hat mich ProSieben Maxx mit zwei Folgen auf DVD, weil ja die erste Folge am kommenden Mittwoch (22.10 Uhr) probehalber dort in der Originalversion läuft, bevor es am Sonntag dann bei Sat.1 (23.15 Uhr) synchronisiert losgeht. Nichtsahnend und oberskeptisch habe ich die DVD eingeschoben und war fest entschlossen, mich nicht einfangen zu lassen.
Zu groß war meine Skepsis durch dieses ganze Erzählen von der sensationellen Netflix-Produktion nach einem britischen Vorbild, von der beeindruckenden Kevin-Spacey-Rede in Edinburgh, von dem Umstand, dass man die ganze Serie auf einen Schlag aus dem Netz saugen konnte. Ich hielt „House Of Cards“ für den nächsten großen Hype, die nächste Sau, die durchs Fernsehdorf getrieben wird. Ich hatte die Klatsche, die ich diesem Machwerk verpassen wollte, schon parat. Und dann das.
Die DVD war noch nicht mit dem Abspann fertig, da nestelte ich bereits am PC und kaufte die nächsten Folgen ein. Hatte ich eine gesaugt, stellte sich keinerlei Befriedigung ein. Ich wollte mehr. Und zwar sofort. Scheiß aufs lineare Programm. Vermutlich liebe ich fortan auch Salatbüffets. Ja, ich gestehe: Ich bin süchtig.
Ich liebe Frank Underwood, diesen politischen Strippenzieher aus Washington, diesen Neuzeit-Machiavelli, diesen hundsgemeinen Zyniker. Ich verstehe allerdings, warum er Zyniker ist. Gerade hat er dem Präsidenten einen traumhaften Wahlkampf organisiert und sich durchaus berechtigt Hoffnung auf den Posten des Außenministers gemacht, da wird er von der Administration abgewatscht. Man brauche ihn anderweitig, wird ihm lapidar beschieden.
Es ist ein großer Spaß, Kevin Spacey bei der Darstellung dieses Frank Underwood zuzuschauen. Wie er im Moment der größten Enttäuschung innerlich explodiert, wie das Kartenhaus seiner Lebensplanung zusammenbricht, wie er aber nach außen ganz ruhig bleibt. Nur er und der Zuschauer wissen, dass dieser Mann fortan eine große Wunde in sich trägt, dass er nicht eher ruhen wird, bis er denen, die ihn gerade abserviert haben, die größtmögliche Verletzung zugefügt hat.
Es ist die große Kunst dieser Serie, einen wie Underwood zum Helden zu machen. Ich war so schnell eingenommen vom Charme dieses Zynikers, dass ich eine Weile auf die Suche gehen musste nach meinen moralischen Maßstäben. Sie hatten sich verkrochen ins hinterletzte Eckchen, denn sie wurden nicht gebraucht. Sie hatten kapiert, welche Freude ich daran hatte, diesem eleganten Ekel beim Anrichten von Schaden zuzusehen. A smart ass – aber ich liebe ihn.
Selten wurde das, was ich für das wahre Wesen von Politik halte, besser beleuchtet. Dabei wirkt etwa der Fall der zurückgetretenen Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke ein bisschen, als habe Sat.1 das Ganze als Promotiontrailer für diese Serie inszeniert.
Die besonderen Momente sind dabei jene, wenn Frank Underwood aus seiner Rolle im Intrigantenstadl heraustritt und mich als Zuschauer persönlich anspricht. Manchmal erklärt er mir, was in ihm oder anderen gerade vorgeht, und bei der Vereidigung des Präsidenten winkt er mir gar zu. Daraus entsteht ein perfektes Geflecht aus Offensichtlichem und Geheimniskrämerei. Dass die Bilder und die Musik dazu passen, versteht sich von selbst.
In der Gesamtkonzeption ist „House Of Cards“ als großer Fernsehrausch angelegt. Es ist Fernsehen, das bewegt und das seinen einzig wirklich bitteren Moment hat, wenn die 13 Folgen zu Ende sind, wenn das Warten beginnt auf die nächste Staffel. Das Fernsehen ist neu, und ich bin dabei. Wo bitte geht es zum Salatbüffet?



 von
von