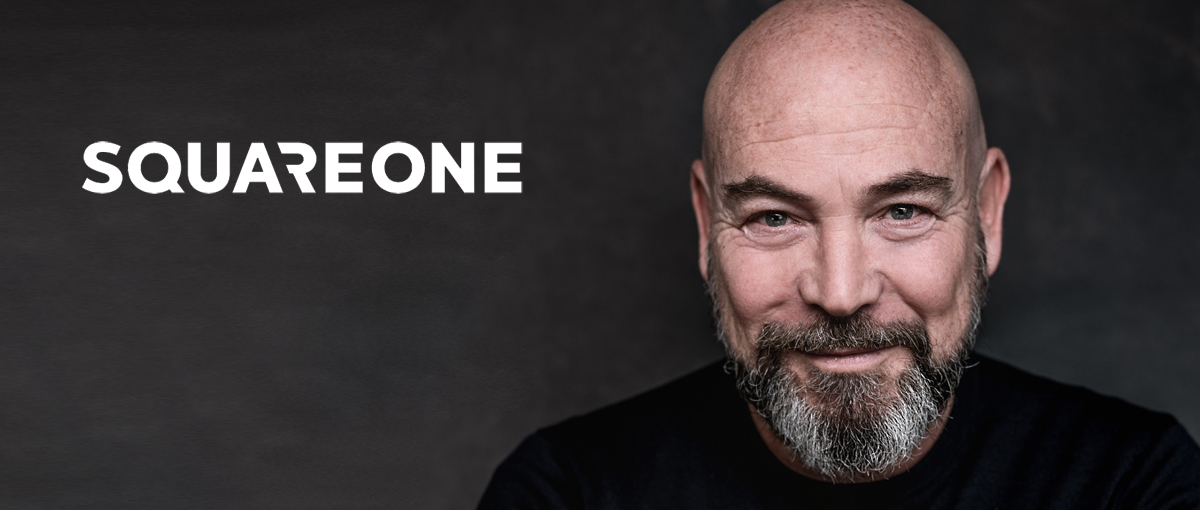Justizirrtümer. Ein Mann, der gegen das System keine Chance hat. Skrupellose Polizisten, die Beweise unterschieben. All das haben wir alle schon tausendmal gesehen, mal sind es ganze Serien, die sich nur um einen solchen Fall drehen, mal sind es einzelne Folgen, die sich damit beschäftigen. Alle Geschichten haben eins gemeinsam: Sie sind erfunden. Die Serie "Making a Murderer" zeigt uns also nichts, was wir nicht schon kennen würden. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die Geschichte ist echt, die Personen sind echt, alle Bilder und Handlungen sind echt.
Was macht das mit uns Zuschauern? Diese Frage kann ich natürlich nur für mich persönlich beantworten: Ich war erst sprachlos, dann geschockt und schließlich wütend. Es wird Sie vermutlich überraschen, dass mich diese Reaktion auf einer anderen Ebene etwas beruhigt hat. Aber dazu später mehr. Die Dokumentationsserie erzählt in zehn Folgen die Geschichte von Steven Avery, einem Mann aus dem nördlichen US-Bundesstaat Wisconsin, der erst 1985 unschuldig ins Gefängnis muss, nach 18 Jahren wieder freikommt, dann auf Schadensersatz klagt - und kurz darauf eines Mordes verdächtigt wird. Von denselben Polizisten, die schon im ersten Fall von vornherein von seiner Schuld ausgegangen waren. (Mehr werde ich aus Spoiler-Gründen nicht verraten, und wer die Doku sehen will, sollte zwischen den Folgen auf keinen Fall nach Zusammenhängen googeln, das könnte wirklich zu viel vorwegnehmen.)
Die Serie ist packender als viele andere, die ich in den vergangenen Monaten gesehen habe. Und wirft viele Fragen auf, denen sich der Zuschauer nicht entziehen kann: juristische, rechtsstaatliche, moralische, ethische. Ich kann fast keine der Fragen, die mich seit dem Ende der Serie beschäftigen, beantworten. Und das frustriert mich. Was mich allerdings beruhigt (und damit komme ich zurück auf den Gedankengang von vorhin): dass mich die Geschichte derart mitnimmt. Denn Sprachlosigkeit, Schock und Wut als Gefühle beim Seriengucken kenne ich natürlich. Aber sie fühlen sich anders an als das, was "Making a Murderer" in mir ausgelöst hat. Es ist gar nicht so einfach, den Unterschied zu beschreiben. Vielleicht wird klarer, was ich meine, wenn ich die Gefühle anders nenne: Unterhaltungssprachlosigkeit, Unterhaltungsschock und Unterhaltungswut.
Also: Bei einer fiktiven Serie bin ich zwar in dem Moment oder auch etwas länger sprachlos und geschockt oder auch wütend. Aber diese Gefühle halten nicht an, wenn ich mich bewusst etwas anderem zuwende. Wenn ich also aus der Unterhaltungssituation heraustrete, streife ich die Unterhaltungssprachlosigkeit, den Unterhaltungsschock und die Unterhaltungswut ab. Doch die Gefühle, die die Dokuserie in mir erzeugt, werde ich nicht so leicht los. Seit Montag, der Tag an dem ich die erste Folge gesehen habe, trage ich in mir eine Wut auf das US-Justizsystem, die mit jedem Tag des Guckens größer wurde. Hier ein Beispiel von einer Nebenfigur, mit der ich nichts verrate, das Ihnen aber vielleicht näher bringt, was ich meine: Es tat mir in der Seele weh, zuschauen zu müssen, wie ein offensichtlich geistig etwas benachteiligter 16-Jähriger von Polizisten im Verhör auf unethische Weise bedrängt wird. Wie er einen Verteidiger an die Seite bekommt, der eine Karikatur des Pflichtverteidiger-Jobs ist, wie sie kein Drehbuchautor besser erfinden könnte. Und ich leide jetzt, beim Schreiben dieses Textes, noch immer mit dem 16-Jährigen und seiner Mutter.

Die Frauen hinter "Making a Murderer": die Dokumentarfilmerinnen Laura Ricciardi (l.) und Moira Demos (r.) bei der Arbeit mit Kamerafrau Iris Ng.
Natürlich weiß ich, dass die beiden Schöpferinnen von "Making a Murderer", Laura Ricciardi und Moira Demos, Gefühle wie diese beim Zuschauer erzeugen wollen - mit ähnlichen Mitteln wie es auch Macher fiktiver Serien tun. Es war ihre bewusste Entscheidung, wen sie wie lange und auf welche Art zu Wort kommen lassen, welche Bilder sie zeigen, welche Fakten sie in den Mittelpunkt rücken, welche Musik sie verwenden. Und nicht zuletzt der Titel macht klar, wo hier die Sympathien liegen sollen. Dennoch: Die Ereignisse, die die Serie zeigt, sind ein Skandal. Und ich bin etwas erleichtert, dass sie in den USA stattfinden und nicht in Deutschland. Die Distanz und die Unterschiedlichkeit der Justizsysteme führen dazu, dass meine Gefühle einfacher zu ertragen sind.
Ich schulde Ihnen noch eine Erläuterung zu dem Hinweis, warum es mich beruhigt, dass "Making a Murderer" die von mir beschriebenen Gefühle auslöst: Weil es mir zeigt, dass mich diese extremen Gefühlswelten, denen ich mich beim exzessiven Seriengucken aussetze, nicht abgestumpft haben. Denn, wenn ich ehrlich bin: Wäre die Geschichte von Steven Avery keine echte, hätte ich sie unter "Ach, schon tausendmal gesehen" einsortiert und nach einer Folge ausgeschaltet.
Durch das Differenzieren der Gefühle habe ich für mich übrigens auch die Meta-Frage beantwortet, die im Zusammenhang mit der medialen Aufbereitung echter Ereignisse immer wieder gestellt wird: Darf das Leid Anderer dem Unterhaltungszweck dienen? Meine Antwort: Nein, darf es nie. Aber "Making a Murderer" will uns schließlich nicht unterhalten, sondern einen skandalösen Fehler im System aufzeigen. Die Unterhaltung ist hier das Mittel zum Zweck und nicht umgekehrt.
Wer "Making a Murderer" zu Ende geschaut hat und die erste Staffel des Podcasts "Serial" noch nicht kennt, sollte das dringend nachholen. Diese amerikanische Serie zum Hören hat 2014/2015 für Aufsehen gesorgt, weil es sich ebenfalls um einen echten Mordfall handelt, den die Journalistin Sarah Koenig recherchiert hat und über den sie Woche für Woche berichtet.
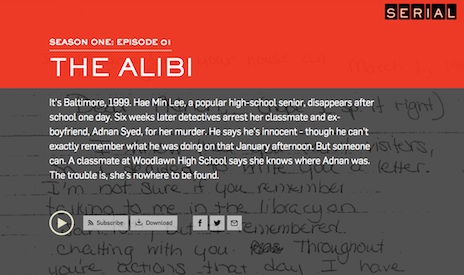
Eine Highschool-Schülerin wird 1999 ermordet aufgefunden, ihr Ex-Freund wird verdächtigt. Und obwohl die Beweise nicht unbedingt eindeutig sind, wird er verurteilt und sitzt seitdem im Gefängnis. Anders als die TV-Dokureihe bezieht "Serial" nicht Stellung, sondern Macherin Koenig nimmt ihre Hörerschaft mit auf die Suche nach der Antwort auf die Frage, ob Adnan Syed das Mädchen getötet hat. Und zeigt nebenbei mehrere Schwächen im US-Justizsystem auf. Der Podcast war in den USA sehr erfolgreich, sogar bis nach Deutschland schwappte die Welle der Faszination. Es gab unzählige Artikel, Foren, Podcasts, Subreddits, die sich damit beschäftigten, und es haben sogar einige Menschen angefangen, auf eigene Faust Beweise zu sammeln.
Etwas Ähnliches passiert übrigens gerade im Fall Steven Avery: Das Vorgehen der Beteiligten wird in den USA heftig diskutiert, Menschen fangen an, Beweise zu sammeln und bestimmte Praktiken in Frage zu stellen. Ich hoffe sehr, dass eine direkte Folge der TV-Serie ist, dass bestimmte Methoden von Ermittlern unterbunden werden. Das wäre zumindest ein erster Schritt, um dem alles entscheidenden Grundprinzip der Unschuldsvermutung besser gerecht zu werden. Denn das Fazit, das Averys früherer Berufungsanwalt Robert Henak in der letzten Folge zieht, ist eine Bankrotterklärung des Justizsystems: "Until it happens to you or your son or daughter or someone else you love, it's easy to ignore all of the problems in the system. But I can guarantee you that once it happens to somebody you love or yourself, it'll be very clear."
Jetzt zum wirklich Wichtigen: Wo kann man das gucken und hören, über das ich schreibe?
"Making a Murderer": Nur auf Netflix.
"Serial" Staffel 1: Die erste Staffel kann man entweder direkt auf der "Serial"-Website Folge für Folge herunterladen oder bei iTunes oder per Podcast-App auf dem Handy hören.
Wer mir auf Twitter folgen möchte, kann das hier tun: @FrauClodette.



 von
von