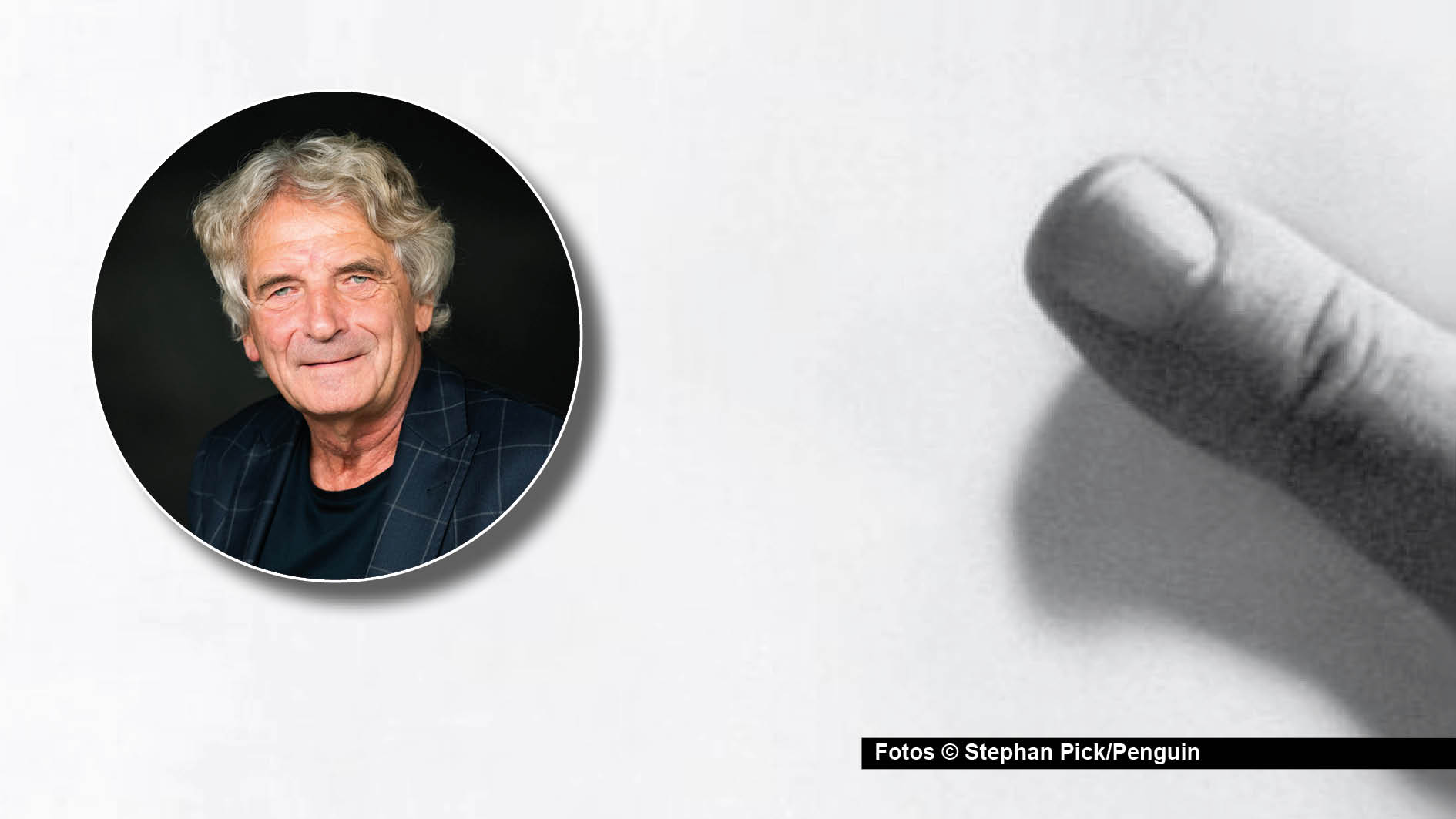Frau Strobl, wenn man laut Jobbeschreibung zwar die Verantwortung trägt, sich aber nur wünschen kann, was passieren soll, weil andere die Budgets kontrollieren: Was macht den Job der ARD-Programmdirektion so attraktiv?
Die Programmvielfalt der ARD und das gemeinsame Ringen mit allen Beteiligten um das beste Angebot. Das kann manchmal herausfordernd sein, weil wir in der ARD eine große auch regionale Buntheit versammelt haben. Dieser intensive, oft auch kontroverse Austausch trägt aber wesentlich zur Qualität unserer Angebote bei. Entschieden wird dann im Vier-Augen-Prinzip.
Ist das in der ARD nicht eher ein Ringen unter weit mehr Augen?
Ich meinte das jetzt bezogen auf den Dialog zwischen den Ideen aus den Landesrundfunkanstalten und uns in der Programmdirektion, wo wir gemeinsam mit unseren Koordinatoren austarieren, wie sich diese Ideen stimmig in unser Gesamtangebot integrieren lassen. Ich habe mich natürlich mit der Frage beschäftigt, ob ich nochmal die Energie finde, das weitere fünf Jahre zu machen - und auch Lust darauf habe. Die Antwort fiel sehr eindeutig aus.
Was ist Ihr Antrieb?
Wir haben in den vergangenen fünf Jahren so viel angeschoben, wie etwa die Umschichtung von Budget in die ARD Mediathek, um dort ein noch besseres Programmangebot für jüngere Zielgruppen zu schaffen. Das trägt jetzt Früchte - und lässt sich gleichzeitig noch grundsätzlicher denken: Befreien wir uns von der Frage nach Ausspielwegen, denken ganzheitlich in Ideen und schauen dann, wie man sie realisiert: Linear, in der Mediathek, in Social Media oder in Kooperationen.
Aber nochmal zur Eingangsfrage: Eine Programmdirektion ohne eigenes Budget, würde man heute vermutlich nicht mehr so anlegen, oder?
Wer keine Lust auf die ARD und ihre Unterschiedlichkeit hat, der sollte ihr fernbleiben. Ich bin ein Kind der ARD und liebe das. Auch den Wahnsinn, den das manchmal bedeutet; aber wir haben einen entscheidenden Vorteil: Bedenken Sie, wie die meisten nationalen und insbesondere internationale Unternehmen die Regionalität und Nähe zum Publikum erst herstellen müssen. Ich amüsiere mich, wenn ich überlege, wie selbst ein so internationaler Konzern wie Coca Cola mit großem Aufwand versucht, sich lokal aufzustellen. Diese Bindung und Nähe, diese Verankerung haben wir in unserer DNA. Und können das zu unserem Vorteil nutzen, um aus den Landesrundfunkanstalten ein Gemeinschaftsangebot im Ersten, der ARD Mediathek und auf allen weiteren Ausspielwegen zu machen – das dabei auch immer wieder international konkurrenzfähig ist.
"Wir wollen nicht einfach nur Inhalte rausblasen, besonders nicht auf Plattformen, auf denen wir dann keine Kontrolle mehr darüber haben"
Was haben Sie sich für die neue Amtszeit vorgenommen?
Das Wichtigste bleiben die richtigen Inhalte, das ist Herausforderung Nr.1. Aber unsere Arbeit hört schon lange nicht mehr mit den Inhalten auf. Manche sagen: Content is king, Distribution is Queen. Wir haben immer seltener das Zuhause auf Taste 1 oder 3 der Fernbedienung. Wir müssen im Digitalen die ARD zu einem relevanten attraktiven medialen Zuhause zu machen. Wichtig ist, dass die Daten bei uns sicher sind und wir kuratieren können. Wir wollen nicht einfach nur Inhalte rausblasen, besonders nicht auf Plattformen, auf denen wir dann keine Kontrolle mehr darüber haben, was mit ihnen passiert. Wir dürfen uns nicht darauf reduzieren lassen, Inhalte zu produzieren und die dann z.B. bei YouTube hochladen - einem Konzern, der nicht ins Risiko oder Investment in Inhalte geht. Ich sehe es als unsere Aufgabe in dieser auseinanderdriftenden Welt als ARD eine verlässliche Heimat zu schaffen, einem Ort der Bindung und wo uns gerade in der digitalen Welt die Menschen vertrauen können.
Die Mahnung hört man oft, dennoch: Auch die ARD nutzt intensiv diverse BigTech-Plattformen für sich. Wie passt das zusammen?
Das ist ein Balance-Akt. Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind, aber immer mit einem klaren Ziel: Die Menschen letztlich zu unseren eigenen Angeboten zu holen, wo wir auch die Kontrolle über die Kuratierung und das Gesamtangebot haben. Spannend ist es doch, wenn wir im Ersten die Menschen mit einem Donnerstagskrimi bestens unterhalten und dann ein Millionenpublikum an eines unserer Politmagazine übergeben können. Und in der Mediathek können wir das Heranführen an unsere Content-Vielfalt besser gewährleisten - anders als die plumpen Empfehlungslogiken mancher Plattformen, die immer nur mehr von dem vorschlagen, was man mag und kennt.
Dann braucht die ARD-Mediathek besondere Algorithmen, denn die Logik „Dir gefällt das, hier ist mehr davon“ widerspricht doch dem öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Die Stage auf der Startseite der ARD-Mediathek ist unsere neue Primetime. Das Ringen darum ist ungefähr so intensiv geworden wie die jahrzehntelange Frage, was wir im Linearen um 20.15 Uhr platzieren. Sie spiegelt auf den ersten Blick unsere Angebotsvielfalt, auch die Aktualität übrigens. Das unterscheidet uns von vielen anderen Angeboten. Wir sind keine Videothek. Wenn in Gaza die Geiseln freigelassen werden, dann ist das nicht nur News im linearen Programm, sondern natürlich auch in der Mediathek auf der Stage. Und dann bin ich völlig bei Ihnen: Die Algorithmen müssen einer öffentlich-rechtlichen Logik folgen. Wir müssen immer journalistische Qualität, aber auch Vielfalt gewährleisten, ob durch die Auswahl von Formaten oder auch innerhalb von Formaten, und diese auch gezielt anbieten. Anderes Beispiel: Wir können Krimi-Fans nicht einfach nur noch mehr Krimis vorschlagen. Aber richtig und wichtig ist auch: Wenn jemand für ein Genre oder Format zu uns kommt, sollten wir eine Antwort darauf haben, mit was wir die Person danach bei uns halten können. Sonst verlieren wir sie so schnell, wie wir sie gewonnen haben.
Das bringt uns zu den „Werwölfen“. Das Reality-Format steht derzeit sehr für sich.
In der Unterhaltung haben wir mit den „Werwölfen“ zum ersten Mal ein Reality-Format ausprobiert, was sich aber abhebt von dem, was das Privatfernsehen darunter versteht. Wir haben so unser Unterhaltungsangebot von „Schlagerboom“ mit Florian Silbereisen über unsere sehr erfolgreichen Quiz- und Gameshows am Vorabend und in der Primetime um eine neue Farbe erweitert. Mich freut, dass sich der Mut auszahlt und wir uns nicht ausruhen. Wir haben jetzt schon mehr als drei Millionen Abrufe in der Mediathek und beobachten eine stetige dynamische Entwicklung. Auf Social Media gab es zu 90 Prozent positives Feedback und wir merken, dass wir Menschen erreichen, die die ARD sonst eher selten nutzen. Die Herausforderung ist jetzt, die neu gewonnenen Nutzenden bei uns zu halten, in dem wir sie mit unseren weiteren attraktiven Angeboten dazu verführen, uns ihre Zeit zu schenken.
Deswegen plant die ARD nach DWDL-Informationen fürs kommende Jahr gleich mit drei Reality-Formaten, wobei gerade nach Ideen gesucht wird.
Ob es genau drei sind, müssten Sie den ARD-Unterhaltungskoordinator fragen. Mir geht es vor allem darum, dass wir in diesem Bereich mehr machen - allerdings immer nur Reality-Formate, die zur Marke ARD passen. Das Signal, auch in diesem Genre mehr zu experimentieren, habe ich bereits an die Kolleginnen und Kollegen gegeben.
Das klingt so, als wenn man die Aussage wagen könnte, dass „Werwölfe“ eine zweite Staffel bekommt?
Die Aussage kann man wagen, aber die finale Entscheidung wird wie immer im Vier-Augen-Prinzip gefällt. Ich kann nur sagen: Wenn wir Erfolge haben, sollten wir sie eher fortführen. Es steht uns gut zu Gesicht, neben der Weiterentwicklung unser etablierten erfolgreichen Formate, wo wir z.B. bei „Wer weiß denn sowas“ mit Wotan Wilke Möhring einen tollen neuen Teamkapitän gefunden haben, auch ganz Neues zu wagen: Im Übrigen haben wir auch mit Kai Pflaume vor Weihnachten noch etwas Besonderes in der ARD Mediathek vor.
"Wir haben lange sehr angestrengt versucht, mit dem linearem Angebot junge Menschen zu erreichen – obwohl das ihrem Mediennutzungsverhalten immer weniger entspricht"
Wenn wir die Kurven zur Nutzung des linearen TV und die der Nutzung der Mediathek anschauen, dann sehen wir anhaltende Tendenzen: Wird die Mediathek am Ende Ihrer Amtszeit das lineare Fernsehen in der Bedeutung überholt haben?
In unserer internen Einschätzung sind wir heute schon bei einer 50:50-Betrachtung. Die Mediathek ist für uns auf Augenhöhe mit dem Linearen. Geeignete Angebote dort zu platzieren, ist für uns der richtige Weg, um Zielgruppen zu erreichen, die wir schon lange nicht mehr mit klassischem linearen Fernsehen erreichen und die uns genauso finanzieren. Wir sind damit im Übrigen sehr erfolgreich, das wird oft unterschätzt. Wir haben im Monat eine kumulierte Netto-Reichweite von rund 25 Millionen. RTL+ oder Joyn jubeln bereits über 10 Millionen. Die öffentlich-rechtlichen Angebote sind zusammen auch stärker als Netflix. Deswegen vermute ich, dass die Mediathek am Ende meiner zweiten Amtszeit eine noch größere Rolle spielen wird.
Läuft der lange kultivierte Vorwurf, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Linearen keine allzu großen Anstrengungen unternimmt, jüngere Menschen anzusprechen, in Mediathek-Zeiten ins Leere?
Wir haben lange sehr angestrengt versucht, mit dem linearem Angebot junge Menschen zu erreichen – obwohl das ihrem Mediennutzungsverhalten immer weniger entspricht. Heute sind wir weiter: Wir versuchen nicht mehr krampfhaft, etwas zu veranstalten, was linear gar nicht gesucht wird, sondern nutzen die Möglichkeit der Mediathek.
Das klingt fast ein bisschen nach Erleichterung…
Heute sehen wir zwei komplementäre Angebote – und doch sind beide die ARD. Im klassischen linearen Fernsehen sind 13 Prozent unserer Zuschauer 14- bis 49-Jährige. In der Mediathek macht diese Altersgruppe stolze 40 Prozent aus, was natürlich auch mit dem Konsumverhalten von Generationen zusammenhängt. Wir sehen: Die Mediathek wird im Verhältnis zur linearen TV-Nutzung gleichmäßiger über den Tag verteilt und auch mobil stärker genutzt. Aber ich möchte nicht außer Acht lassen: Wenn’s wichtig wird, wissen auch die Jungen, was sie im Linearen an uns haben. Bei besonderen Nachrichtenlagen, bei Sport oder Live-Ereignissen wie dem Eurovision Song Contest kommen die Menschen gezielt ins Erste.
Der „Eurovision Song Contest“ war in diesem Jahr nach Publikumsinteresse so erfolgreich wie lange nicht, mit Vorentscheid und dem Finale aus Basel. Trotzdem wird die Zusammenarbeit mit RTL und Stefan Raab nicht fortgesetzt. Warum?
Das war eine tolle Partnerschaft, auf die ich stolz bin. Aber es war auch eine Challenge, die wir zusammen mit Stefan Raab sehr ernstgenommen haben. Wir haben gesagt: Wir gehen diese Partnerschaft ein, weil wir gewinnen wollen. Jetzt ein Jahr später zu sagen: Gut, hat nicht geklappt, wir machen trotzdem einfach weiter, fühlt sich nicht gut an. Für nächstes Jahr hat der SWR als Federführer in der ARD mit uns entschieden, erstmal nicht auf eine Kooperation mit einem anderen Sender zu setzen. Ich glaube, dass einem auch etwas Neues einfallen müsste, wenn man das Thema Kooperation beim ESC für die Zukunft nochmal angeht, aber das ist ja absolut denkbar und möglich.
"Der ESC ist ein Wettbewerb, der von EBU-Sendern und nicht von Staaten veranstaltet wird. Für uns ist es ganz klar so, dass der israelische Sender Kan alle Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllt"
Und wer produziert den jetzigen Vorentscheid?
Das wird der SWR zu gegebener Zeit kommunizieren. Die Suche der Acts läuft natürlich bereits. Vorgelagert ist gerade noch ein anderes Thema. Ich begrüße aktuell, dass die EBU entschieden hat, im Dezember bei einem persönlichen Treffen darüber zu beraten, wie man mit der Teilnahme Israels und dem Hochhalten der Werte dieses Wettbewerbs umgeht. Der ESC ist ein Wettbewerb, der von EBU-Sendern und nicht von Staaten veranstaltet wird. Das muss man immer dazu sagen. Und für uns ist es ganz klar so, dass der israelische Sender Kan alle Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllt. Aber den Dezember gilt es jetzt abzuwarten, auch um zu wissen, wie viele Länder beim ESC in Wien antreten werden.
Die Zusammenarbeit mit RTL war eine Public-Private-Partnerschaft, wie sie die Medienpolitik gerne häufiger sehen würde. Ist die ARD offen für mehr Kooperation?
Definitiv, das ist eins der großen Themen, nicht nur weil uns der Reformstaatsvertrag mehr Dialog und Kooperation vorgibt - mit Stoßrichtung zunächst einmal zum ZDF, aber auch zu privaten Anbietern. Auch wenn unter dem Vertrag die Tinte noch nicht trocken ist, scheint diese Perspektive ja klar und wird von uns im Übrigen auch schon länger gelebt. „Babylon Berlin“ war vor einigen Jahren ein erstes großes Beispiel dafür. Wir haben auch super Erfahrungen gemacht im Bereich des Sports und gerade wieder einen neuen Deal mit Magenta TV für die Fußball-WM und EM abgeschlossen. Ich bin offen für jeden Austausch, so lange er auf Augenhöhe passiert. Weniger in der Information, da setzen wir auf Eigenständigkeit und journalistische Vielfalt mit der Konkurrenz. Aber im Bereich Sport oder Unterhaltung, und auch wenn es um Themen-Schwerpunkte oder Aktionen geht, kann ich mir vieles vorstellen. Warum nicht mal eine gemeinsame Serien-Produktion mit Disney oder Netflix realisieren? Also auch gemeinsam planen, nicht im Nachhinein lizenzieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir schon bald neue Formen von Kooperationen und auch neu gedachten Verwertungsfenstern erleben werden.
Hätten besondere Serienprojekte weiterhin die Chance im Linearen platziert zu werden oder ist das automatisch Mediathek?
„Hundertdreizehn“ ist ein super Beispiel, weil es unsere Möglichkeiten zeigt: Wir können das Lineare sehr gut nutzen, um dort etwas mit einer großen Breitenwirkung anzustoßen. In diesem Fall hat es im klassischen Fernsehen am ersten Tag hervorragend funktioniert. Am zweiten Tag hat es im Ersten nachgelassen, auch weil die Nutzenden sofort alle Folgen in der Mediathek schauen konnten. Insofern ist doch die Erkenntnis, wir haben im Ersten die Möglichkeit, Programme in der Mediathek anzuschieben, auf die manche Streamingdienste neidisch sind. Damit werden wir in Zukunft noch deutlich stärker spielen, also Programme im Ersten mit zwei, drei Folgen anschieben, dann aber gar nicht in Gänze dort ausstrahlen, sondern an die Mediathek übergeben, wie wir das auch schon bei den „Werwölfen“ getan haben.
Das Zusammenspiel von Linear und Mediathek wollen Sie auch bei den Polittalks angehen. Da ist die ARD im Linearen erfolgreich, aber Sie suchen nach einer Übersetzung des Genres für die Mediathek?
Ich möchte nicht so schnell darüber hinweg gehen: Mit allen drei Polit-Talks, also „Caren Miosga“, „Maischberger“ und „Hart aber Fair“ haben wir im Ersten seit 2023 die Marktanteile gesteigert und auch in der Mediathek zugelegt. Auch das ist Ergebnis stetiger Weiterentwicklungen. Aber dort sehen wir auch, dass wir mit der Idee einer Gesprächsrunde im Studio im Digitalen an gewisse Grenzen stoßen. Deswegen wollen wir mit Louis Klamroth zusätzlich zu „Hart aber Fair“ neue Antworten finden auf die Frage, wie politischer Diskurs in der Mediathek aussehen kann. Und ihn auch ganz bewusst benutzen, um jüngere Menschen genau dafür zu interessieren. Gerade jüngere Zielgruppen haben auch einen Anspruch darauf, dass wir ihnen in diesem Segment ein attraktives Angebot machen, das hat auch etwas mit Mittelgerechtigkeit zu tun. Wir suchen nach etwas, was die Idee eines politischen Studio-Talks übersetzt, also Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zum Diskurs zusammenbringt. Das ist eine Priorität fürs nächste Jahr. Wir wollen außerdem mit Louis Townhall-Formate schaffen, die den direkten Dialog ermöglichen – und zugleich auch im Ersten neue Impulse mit ihm setzen.
Bleiben wir bei der Information. Da gabs in diesem Sommer eine Fast-Revolution, aber dann doch nicht: Die Verlängerung der „Tagesschau“…
Wie eben schon gesagt: Wir wollen experimentieren und dabei gibt es in den Diskussionen keine Tabus. Manchmal landen Ideen in der Öffentlichkeit, die noch gar nicht dafür bestimmt waren. Worum ging es? Wir haben mit der „Tagesschau“ die vertrauenswürdigste und erfolgreichste Nachrichtenmarke im deutschen Fernsehen, die wir erfolgreich auch in App und Social Media verlängert haben. Bei TikTok sind wir die erfolgreichste News-Brand in Deutschland. Und ein Teil der Überlegungen rund um die Marke war die Verlängerung der „Tagesschau“ am Montagabend. Das wurde intern diskutiert, getestet und festgestellt, dass es nicht so aufgeht, wie wir uns es vorgestellt haben. Ich rate uns da allen zu mehr Gelassenheit. Wir können nicht Experimente fordern, aber kein Risiko beim Testen eingehen wollen. Die Sehnsucht nach Vertiefung bleibt. Wir werden weitersuchen, um die richtigen Formen in Nachrichtenformaten, auch für Themen von Kultur und Wissenschaft, zu finden.
"Wir sind an allen Stellen in Bewegung, aber als zu wild würde ich die ARD trotzdem nicht beschreiben."
Die „Tagesschau“ verlängern, in die Reality einstiegen: Zwei Experimente in diesem Sommer, kurz vor Ihrer Vertragsverlängerung. Jetzt ist die durch - wird es jetzt erst richtig wild in der ARD-Programmdirektion?
(lacht) Mein Vertrag steht ja noch unter dem Gremienvorbehalt, also der Zustimmung des Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks. Aber den Vorwurf, dass die ARD zu wild sei, habe ich jetzt noch nicht zu oft gehört. Wir sind gerade in einem guten Fluss, mit einer gesunden Mischung aus dem Bewahren von erfolgreichen Marken, die tolle Jubiläen feiern - und dem Mut, an anderer Stelle auch ganz anders zu denken. Auch im Dokumentarischen, weil wir eben schon dabei waren: „Die Küblböck-Story“, „Being Franziska van Almsick“ oder „Rise & Fall“ sind drei Beispiele nur aus den vergangenen und aktuellen Monaten, die großartig sind. Da stößt das emotionale serielle Erzählen auf die Informationskompetenz der ARD. Das wird in der Mediathek enorm nachgefragt. Ich freue mich auch schon auf „Being Katarina Witt“. Dann haben wir aber auch aus den Redaktionen unseren etablierten Politikmagazine das neue Format "team.recherche" gegründet, um sich einer jungen Form des Investigativjournalismus anzunehmen. Wir sind also an allen Stellen in Bewegung, aber als zu wild würde ich die ARD trotzdem nicht beschreiben.
Nächstes Jahr kommt die finale Staffel von „Babylon Berlin“, das war im Ursprung das Ergebnis einer Kooperation und ein serielles Mammut-Projekt. Braucht es den nächsten Leuchtturm?
Unbedingt! Ich glaube, es braucht genau solche Leuchttürme. „Babylon Berlin“ ist ein spektakulärer Erfolg für uns, weil wir mit jeder neuen Staffel immer auch eine enorme Neunutzung der bisherigen Staffeln erlebt haben. Das ist die Idealvorstellung für langlaufende Highend-Serien. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf „Ludwig“, wo gerade die Dreharbeiten im vollen Gange sind. Das ist vielversprechend. Wir haben aber gerade in Berlin auch mehrere Serienhighlights vorgestellt. Von „Schwarzes Gold“ über die Folgestaffeln von „Almania“ und „Asbest“ bis zu „Mozart/Mozart“. Nur weiß man nicht immer vorher, welche Idee am Ende ein Leuchtturm wird. Manchmal sind es auch die unscheinbaren Ideen. Aber angesichts der Budgets mancher Konkurrenten wird das nicht einfacher, da sind wir dann wieder beim Thema Kooperation oder Koproduktion, neuen Wegen und vielversprechenden Gesprächen.
Frau Strobl, herzlichen Dank für das Interview.



 von
von