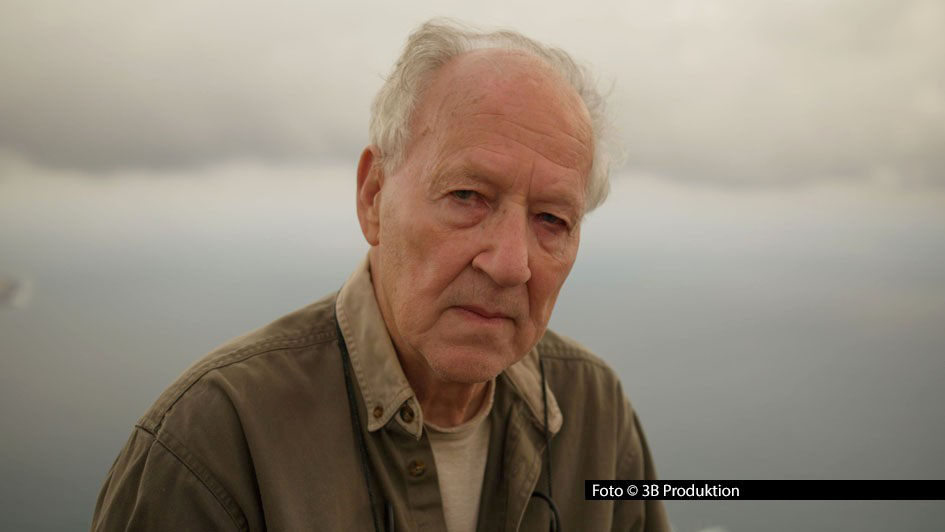Sprach man Verantwortliche in der TV-Branche im vergangenen Jahr auf Claudia Roth an, dann war das Seufzen unüberhörbar. Zwar hatte die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Anfang 2024 bei der Berlinale eine große Reform der Filmförderung angekündigt – doch dann wurde der Prozess so lange verschleppt, dass die Hilferufe aus der enorm unter Druck stehenden Produktionslandschaft immer verzweifelter wurden. Letztlich machte der vorzeitige Ampelbruch eine Umsetzung unmöglich. Von Claudia Roth war dazu öffentlich lange Zeit so wenig zu hören, sodass sich manch einer in der Medienbranche schon fast geghostet fühlte.
Darüber, dass man von ihrem Nachfolger Wolfram Weimer in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit wenig gehört hätte, kann sich nun niemand mehr beschweren. Weimer meldet sich praktisch wöchentlich in Interviews zu Wort, sucht offensiv das Gespräch mit Beteiligten, insbesondere aus der Medienlandschaft. So etwas wie seine Lieblings-Formulierung in Interviews: „Deshalb kümmere ich mich darum.“ Weimer, der Kümmerer – das ist offenbar das Bild, das er vermitteln will.
Und man ist teilweise schon überrascht, worum er sich alles kümmert. Als sich abzeichnete, dass die Berlusconi-Holding MFE wohl die Kontrolle über ProSiebenSat.1 übernehmen könnte, da kamen besorgte Töne über den Erhalt des Standorts München oder die Garantie der redaktionellen Unabhängigkeit zuerst nicht etwa aus der Bayerischen Staatskanzlei, sondern aus Berlin. Weimer lud Pier Silvio Berlusconi ins Kanzleramt, wo er ihn Anfang September zum Gespräch trifft.
Ob MFE deswegen Dinge anders macht als geplant? Wenig wahrscheinlich. Doch Weimer scheint es wichtig, damit zu unterstreichen, dass es der Bundesregierung nicht egal ist, wie es mit einem der größten privaten Medienkonzerne und dem Medienstandort Deutschland weiter geht. Auch nach der Ankündigung von RTL Deutschland, Sky Deutschland übernehmen zu wollen, erklärte Weimer postwendend, dass er diesen Schritt begrüße. So könne eine deutsche Plattform von relevanter Größe entstehen, um im Wettbewerb mit globalen Playern zu bestehen, so Weimer. Angesichts der vielen Vorhaben, die in den letzten Jahren nicht nur hierzulande an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert sind, kann politischer Rückenwind dieser Art zumindest nicht schaden.
Die heimischen Medien gegen die Übermacht der US-Plattformen zu schützen, oder von diesen zumindest nennenswerte finanzielle Beiträge zu fordern, war auch das Ziel seines Vorschlags, einen „Plattform-Soli“ nach österreichischem Vorbild einzuführen. „Es herrscht über die Parteigrenzen große Einigkeit, dass die Politik hier endlich handeln sollte“, sagte Weimer. 10 Prozent Abgaben auf Online-Werbeeinnahmen seien „moderat und legitim“. Erstmal wolle er aber zunächst das Gespräch mit Google, Meta und Co. suchen. Die Verhandlungsbasis dort ist allerdings keine allzu gute: Obwohl solche Überlegungen sogar im Koalitionsvertrag festgehalten sind, sprach sich beispielsweise Wirtschaftsministerin Reiche längst dagegen aus, Digitalminister Wildberger zeigte sich zurückhaltend – und aus Angst vor weiteren Zöllen aus den USA wäre Deutschland nicht das erste Land, das ein solches Ansinnen wieder zu den Akten legt.
Die dringlichste Frage, die die deutsche Produktions-, Kino- und TV-Landschaft umtreibt, ist aber ohnehin eine andere: Die Neuaufstellung der Filmförderung. Wie eingangs erwähnt, hat die Ampel-Regierung ihr 3-Säulen-Modell nicht mehr umgesetzt. Landauf, landab war Wolfram Weimer in den letzten Wochen unterwegs, um der Branche zu versichern, dass man an einer Neuordnung arbeite. Gerade angesichts der angespannten Haushaltslage nahm man das allerorten positiv auf – doch auch hier bleibt die Frage, was Weimer letztlich liefern kann.
Ende Juli beschloss das Kabinett dann eine Erhöhung der Filmförderung von 133 auf 250 Millionen Euro über die Fonds DFFF und GMPF. Die frohe Botschaft hat nur zwei ganz große Haken: Das von vielen so sehr herbeigesehnte Steueranreizmodell kommt damit erstmal nicht. Weimer erklärte das mit der Komplexität des Vorhabens, das er nun als „Bürokratiemonster“ ansah und dessen Umsetzung womöglich noch Jahre in Anspruch hätte nehmen können - dabei hatte er dessen Umsetzung noch wenige Wochen zuvor selbst angekündigt. Haken Nummer 2: Geknüpft ist diese Erhöhung an die Einführung einer Investitionsverpflichtung.
Dass Weimer diese schnell per gesetzlicher Regelung auf den Weg bringen will, ist dabei durchaus erstaunlich – denn noch kurz zuvor hatte er zum Streamer-Gipfel geladen und mit den Verantwortlichen von Netflix, Prime Video, Disney+ und Apple TV+ darüber diskutiert, wie man das ganze womöglich auch über Selbstverpflichtungen lösen könnte. Direkte Ergebnisse gab’s zwar nicht, im Anschluss betonten aber alle Beteiligten den „konstruktiven Austausch“. Dass die Streamer dann weniger als eine Woche später aus der Presse erfuhren, dass Weimer einen Gesetzentwurf nun direkt nach der Sommerpause in die Ressortabstimmung geben wolle, ließ diese einigermaßen verschnupft zurück.
Ganz trivial ist auch die Ausarbeitung einer gesetzlichen Investitionsverpflichtung, die dem Standort Deutschland zugute kommt, nicht. Die Ampel etwa hat sich in einem komplizierten Modell an Quoten und Unterquoten derart verheddert, dass am Ende kaum noch jemand durchblickte. Dazu kommen europarechtliche Fragen. Vor allem bedeutet es aber: Durch die Verknüpfung mit diesem Vorhaben bleibt die Erhöhung der Filmfördersumme einstweilen weiter in der Schwebe – und die Verlässlichkeit, nach der die Branche nach den Jahren der Unsicherheit so dürstet, lässt weiter auf sich warten. Die nächsten 100 Tage der Amtszeit von Wolfram Weimer werden für die Branche daher noch weit bedeutender als die ersten, denn jetzt muss er wirklich liefern. Bleibt zu hoffen, dass er sich nun vorrangig um diese Themen kümmert – und weniger um Gender-Verbote.



 von
von