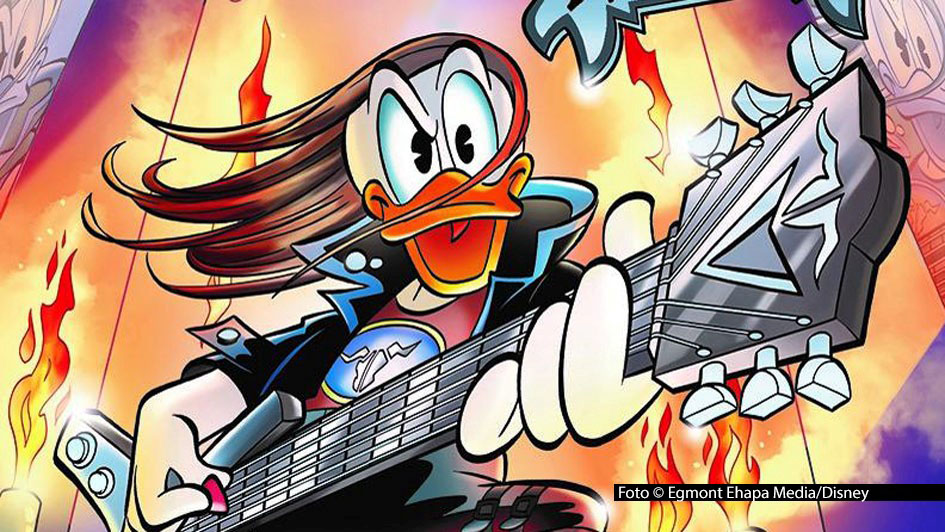Als die Bilder einst, wie heißt es so schön: laufen lernten, wirkten Fotos zwar kurz wieder wie von gestern. Filmdramaturgisch bekamen sie aber bald frische Bedeutung als starre Nebendarstellerinnen bewegter Handlungen – fast perfekt veranschaulicht in der Netflix-Serie „Schlafende Hunde“. Es geht darin, kurz gesagt, um den verwahrlosten Berliner Polizisten Mike Atlas (Max Riemelt), der dank eines traumatisierenden Ereignisses im Dienst Familie, Haus und Arbeit verlassen hat, bis ihn die Absturzursache wieder einholt.
Nicht gemeinsam, aber Seite an Seite mit der angehenden Staatsanwältin Jule (Luise von Finckh), die parallel den Suizid eines Verurteilten aus Mikes letztem Fall aufklären soll, dringt der Ex-Cop in ein undurchdringliches Gestrüpp aus Corps-Geist und Clan-Kriminalität vor, das ihn einst aus der Bahn warf. Damit öffnen sie die Büchse der Pandora (oder stechen je nach Phrasenbedarf ins Wespennest) eines angeblich abgeschlossenen Richter-Mordes, der sowohl Mike als auch den toten Häftling in den Abgrund rechtspolitischer Konflikte gerissen hatte.
Und damit zu den Fotos.
Das dramaturgische Niveau deutscher Fiktionen lässt sich in der Regel nämlich gut daran ablesen, ob sich die Regie aufs Drehbuch verlässt oder nicht. Stephan Lacant und Francis Meletzky trauen der sechsteiligen Kriminalstory von Christoph Darnstädt demnach nur mäßig über den Weg, weshalb sie tun, wozu das Personal zusammengeklöppelter Geschichten regelmäßig verdonnert wird: Immer dann, wenn sie sich im eigenen Durcheinander unzusammenhängender Erzählstränge verheddern, wird auf zweidimensionale Abbildungen ihres Zustandekommens gestarrt.
Dass die zaghafte Assessorin im Schatten ihrer resoluten Mutter an vergleichbarer Position steht, lehrt uns zum Beispiel deren gestrenger Kontrollblick aus gerahmtem Porträt auf Jules Schreibtisch. Dass Mikes Absturz mit Dosenfraß im Trailer ein Familienleben vorausging, erfahren wir, wenn er wehmütig das Bild seiner kleinen Tochter betrachtet. Dass es auch beruflich mal besser lief, zeigt der Schnappschuss unter Kollegen im Spint eines Abgelichteten. Und als sich Privatdetektiv Jürgens an Mikes Fersen heftet, liegt stets ein Zeitungsartikel mit der Überschrift „Polizeibeamter für besondere Dienste geehrt“ auf seinem Beifahrersitz.
Beschattungsprofis wie dieser (Bernd Hölscher), der im diesigen Philip-Marlowe-Gedächtnis-Büroverschlag natürlich schwer am Schwitzen ist, können sich halt partout keine Gesichter merken. Und falls gerade kein Bild handlungsrelevanter Personen zur Hand ist, werden ihre Namen halt sichtbar mit Edding umkringelt oder, noch eindrücklicher: selbst dann laut ausgesprochen, wenn beim Aktenstudium (vornehmlich mit Taschenlampe im nächtlichen Archiv) sonst niemand zugegen ist.
Das Erklärbär-Fernsehen deutscher Provenienz vervollständigen ständig eingestreute Rückblenden, die den Sechsteiler endgültig aufs Niveau kriminalistischer Stangenware von „Der Überfall“ (Lacant) bis „Wolfsland“ (Meletzky) oder Darnstädts Schweiger-Tatorten absenken – nochmals tiefergelegt dank des dräuenden „Hier-passiert-gleich-was-Soundtracks“ von Dürbeck & Dohmen, der mit technoider Beharrlichkeit um Aufmerksamkeit bettelt, aber doch nur dauernd Abschaltimpulse erzeugt.
Zu schade – entfaltet das israelische Original doch massive Sogwirkung. Unterm Titel „The Exchange Principle“ gar Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, zeichnet es ja nicht nur das Sittengemälde einer Gesellschaft im Dauerkriegszustand; es lässt die Hauptfigur (Lior Ashkenazi) so verwahrlosen, dass sich ihr Absturz in jedem Fussel seines seelisch vernarbten Gesichts spiegelt. Das Remake dagegen verlegt seine Handlung einer gesetzlosen Polizei unterm Beschuss dunkler Mächte ins kulturell knifflige, nicht halb so zerrüttete Kreuzkölln, wo Riemelt seinem Atlas zwar spürbar das Gewicht der Erde auf die Schultern legt.
Optisch aber taugt er trotz hygienischer Mängel zum Gilette-Model, das sein Herumirren mit Habseligkeiten im Rucksack noch unglaubwürdiger macht als Martin Wuttkes aasigen Clan-Anwalt, der natürlich Hartloff heißt. Oder einen Seitenstrang der Polizistin Britney (Melodie Siminia), die das Trauma eines im Einsatz verletzten Kindes mit sich rumschleppt. Oder interne Ermittlungen, die deutsche Polizisten bar jeder Realität ernsthaft gegeneinander betreiben. Oder eine Staatsanwältin in spe, deren Debüt von Leichen gepflastert wird, ohne dass ihr je die Selbstkontrolle entgleitet. Oder Mitglieder der Generation Y, die „fahr zur Hölle“ statt „fick dich!“ sagen. Oder das vielleicht lächerlichste Bühnenrandgeständnis im Finale.
Oder. Oder. Oder warum bitte macht die famose Peri Baumeister als verblüffend tolerante Frau des verantwortungsflüchtigen Mike Atlas mit bei diesem Mumpitz namens Thriller-Serie? Vielleicht ja, weil die Story auf öffentlich-rechtliche Art konventionell ist und damit irgendwie vollkaskoversichert. Vielleicht also, weil Lacant & Meletzky mit dem Besteck aus 1001 baugleichen Krimis Spannung erzeugen, die Dürbeck & Dohmen eben sehgewohnheitsgemäß vertonen.
„Schlafende Hunde“ geht somit nicht zuletzt deshalb aussichtsreich ins Netflix-Rennen um Aufmerksamkeit, weil Stromlinienkrimis die Erwartungshaltung so abgesenkt haben, dass selbst Dinge wie „Decision Game“ im ZDF oder „Dünentod“ bei RTL verlässlich Zugriffe erzielen. Was all dies darüber hinaus noch eint: irgendwann streichelt darin garantiert jemand über ein Foto.
"Schlafende Hunde" steht ab sofort bei Netflix zum Streamen bereit



 TV-Kritik von
TV-Kritik von