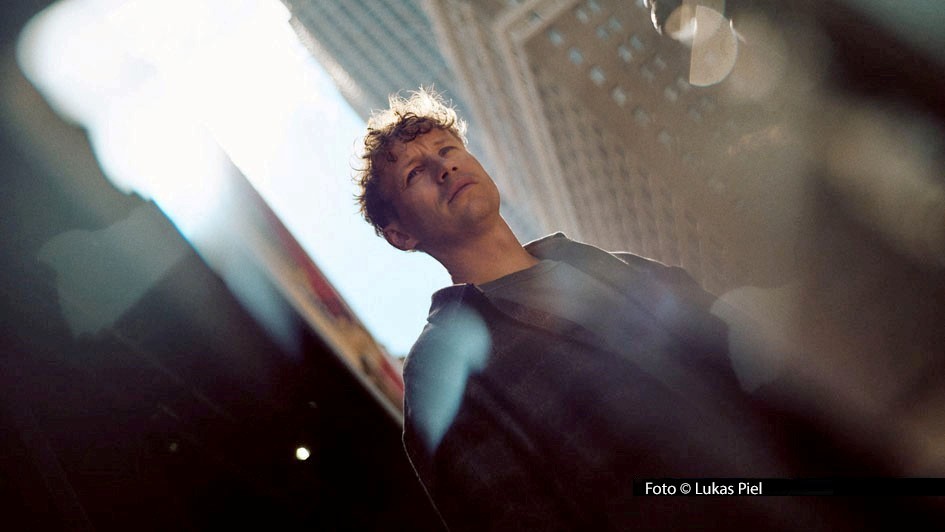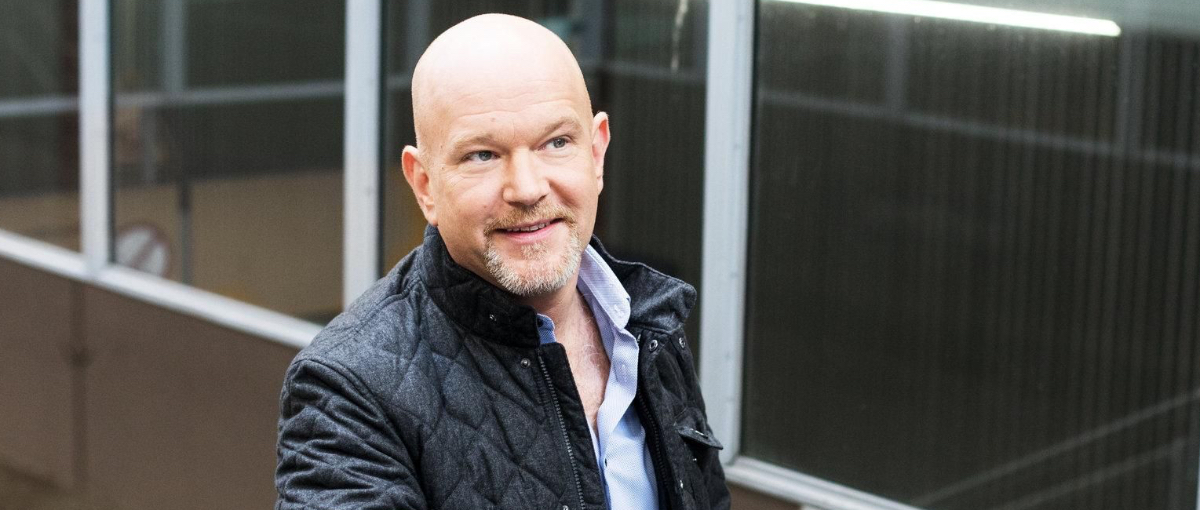"Wir Länder nehmen unsere ureigenste Verantwortung für freie, vielfältige und verlässliche Medien wahr – auch im digitalen Raum. Soziale Medien und neue Technologien wie Künstliche Intelligenz haben die Spielregeln grundlegend verändert", sagte Alexander Schweitzer, der als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz auch der Rundfunkkommission der Länder vorsteht. Und dass dieses Gremium "Rundfunkkommission" heißt, zeigt auch schon, dass viele Regeln angesichts der sich rasant verschiebenden Machtverhältnisse hin zu globalen Plattformen aus der Zeit gefallen scheinen.
Die Arbeiten an einem neuen Digitale Medien-Staatsvertrag sind also überfällig. Die Politik hat sie in zwei Teile aufgespalten. Teil 1, bei der es beispielsweise die Umsetzung des European Media Freedom Acts geht, ist schon auf dem Weg. Spannender ist aktuell aber das, was man sich für einen zweiten Teil aufgehoben hat. Hier geht es darum, mit welchen Maßnahmen man die stark unter Druck stehenden Medienunternehmen stützen kann und welche Regeln man die Betreiber der großen internationalen Plattformen womöglich auferlegen sollte.
Auf Referenten-Ebene waren hierfür schon Vorschläge erarbeitet worden. Die Rundfunkkommission hat sich nun auf drei Ziele als Eckpunkte festgelegt, unter denen die Entwürfe nun weiterentwickelt werden sollen. In Punkt 1 steht unter der Überschrift "Inhalteanbieter und Refinanzierung journalistischer Angebote stärken". Wörtlich heißt es: "Angesichts wachsender wirtschaftlicher Herausforderungen ist eine Überprüfung der bestehenden Regulierungsdichte, insbesondere im Werbebereich, notwendig."
Darauf drängen insbesondere Privatsender schon seit langer Zeit, weil sie sich im Vergleich zu Online-Plattformen ungleich strikterer Regulierung ausgesetzt sehen, was angesichts der Verschiebung von Werbegeldern ein immer drängenderes Problem wird. Eine Lockerung für klassische Anbieter könnte auch mit stäkerer Regulierung für Plattformen einher gehen. Im Referentenentwurf heißt es: "Für Mediendienste und für Vermittlungsdienste (bspw. Video- - oder Audioplattformen), die mit Mediendiensten im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Werbeerlöse stehen, sollten grundsätzlich gleiche Anforderungen gelten."
Weiter heißt es im Eckpunkte-Papier auch, dass "weitere medienspezifische Förderinstrumente" geprüft werden sollen. Sorgen will man zudem für eine bessere Auffindbarkeit von vertrauenswürdigen, journalistischen Inhalten - was auch mit Blick auf die um sich greifenden KI-Zusammenfassungen, durch die Nutzerinnen und Nutzer gar nicht mehr auf Originalquellen gelangen, spannend wird. Interessant auch, dass mit Blick auf Social-Media-Plattformen eine Regelung diskutiert wird, dass "marktmächtige Plattformen" Postings mit Links auf externe Artikel nicht mehr benachteiligen dürfen. "Um Medienvielfalt und verlässliche Inhalte im digitalen Raum zu stärken, sind gezielte Mechanismen für die Stärkung journalistischer Sorgfaltspflichten und zur Auffindbarkeit solcher Inhalte erforderlich. Wir werden daher weitergehende Instrumente einführen", ist die wörtliche Formulierung im Eckpunkte-Papier.
Der zweite Punkt steht unter der Überschrift "Freie Kommunikationsräume gewährleisten und Aufsicht wirksam ausgestalten". Verbunden mit der schon angesprochenen Verbesserung der Auffindbarkeit verlässlicher Inhalte will man auch einen besseren Schutz vor Manipulationen erreichen und "effektive Maßnahmen gegen rechtswidrige Inhalte" auf Plattformen einführen. Dafür soll die Medienaufsicht modernisiert werden, damit diese "mit den dynamischen Entwicklungen des digitalen Medienmarktes Schritt halten" kann.
Und schließlich kündigt man unter der Überschrift "Unternehmerisches Wachstum ermöglichen und Meinungsvielfalt strukturell sichern" eine Reform des Medienkonzentrationsrechts an. Dieses stellt bislang vor allem auf den Fernsehmarkt ab - und verhinderte auch in den letzten Jahren noch regelmäßig die Zusammenarbeit bzw. Fusionen im Medienbereich. Zugleich will man auch hier jene Plattformen in den Blick nehmen, die längst die eigentlichen Gatekeeper sind: "Anbieter, die wesentlichen Einfluss auf den Zugang und die Auffindbarkeit von Inhalten ausüben, müssen ihrer besonderen Verantwortung für Vielfalt gerecht werden. Diese werden wir daher in einem neuen Medienkonzentrationsrecht mit in den Blick nehmen", heißt es im Eckpunkte-Beschluss.
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer erklärte bei der Vorstellung der Eckpunkte: "Ziel ist, die Medienordnung in Deutschland an die Herausforderungen einer zunehmend digitalen und KI-geprägten Kommunikationswelt anzupassen und den Wandel aktiv zu gestalten. Demokratische Medienpolitik heißt für mich, wir wollen in Europa und in Deutschland die Regeln unserer gesellschaftlichen Debatten auch im digitalen Zeitalter selbst erarbeiten und nicht von Tech-Giganten bestimmen lassen."
Der Privatsender-Verband VAUNET begrüßte die Einigung der Rundfunkkommission und sprach von einem "effektiven Maßnahmenbündel". Zugleich mahnte man aber Geschwindigkeit bei der Umsetzung an. Der VAUNET-Vorstandsvorsitzende Claus Grewenig: "Tempo ist für das weitere Vorgehen der Länder angesichts der Geschwindigkeit der digitalen Transformation entscheidend. Nur sofortiges Handeln kann verhindern, dass die Schere zwischen Investitionen in Inhalte und digitaler Wertschöpfung in den Monaten bis zur nächsten politischen Befassung zugunsten der marktmächtigen Big-Tech-Plattformen weiter aufgeht. Wir benötigen daher besser heute als morgen einen Teil 2 des Digitalen Mediendienste-Staatsvertrags."
Mehr zum Thema



 von
von