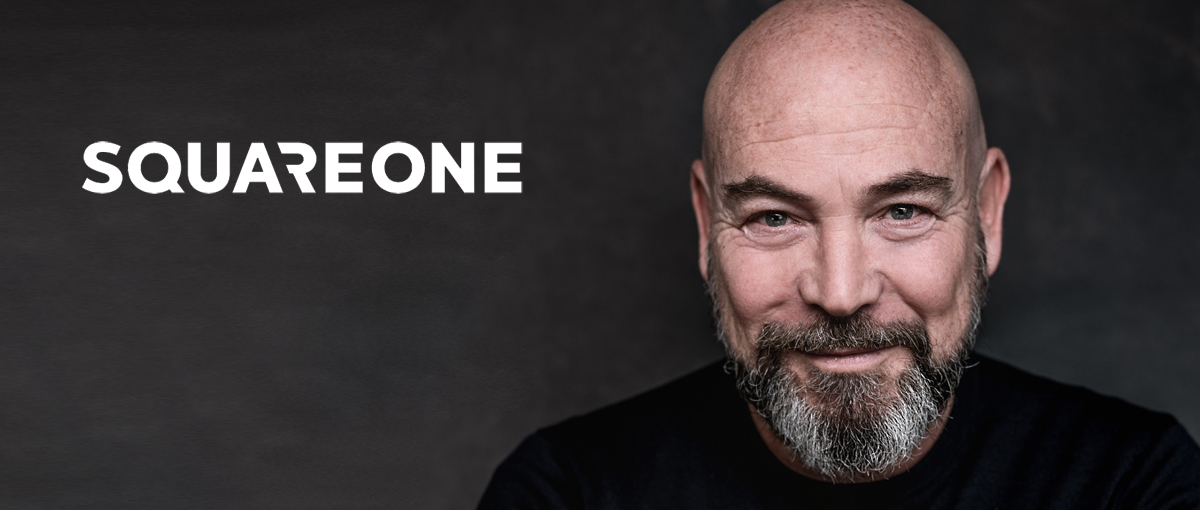Nachdem die "taz" berichtet hatte, dass die Dresdner Polizei bei den Anti-Nazi-Protesten im Februar eine sogenannte Funkzellenauswertung durchgeführt hat und dabei sämtliche eingehenden Anrufe und Kurzmeldungen aller Personen, die sich zum entsprechenden Zeitpunkt dort aufgehalten haben, erfasst und gespeichert hat, geht sie nun juristisch gegen diese Maßnahme vor, da auch Journalisten der "taz" davon betroffen waren.
"Unsere betroffenen Journalisten können ihren Gesprächspartnern und Informanten vom 19. Februar nicht die Vertraulichkeit gewährleisten, die sie ihnen versprochen haben. Mit der Dokumentation der Kommunikationsdaten zahlreicher Journalisten wurde am 19. Februar die Grundlage der Pressefreiheit staatlich außer Kraft gesetzt", so Chefredakteurin Ines Pohl. Sechs Journalisten der Zeitunge legten daher am Donnerstag Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft in Dresden ein. Sie sehen sich durch die Feststellung und Speicherung ihrer Kommunikationsdaten in ihrer Pressefreiheit eingeschränkt und wollen feststellen lassen, dass die Anordnung der Telekommunikationsüberwachung rechtswidrig war, heißt es in einer Mitteilung der "taz".
"Die an der Maßnahme Beteiligten mussten wissen, dass zahlreiche Journalisten vor Ort beruflich tätig waren. Sie wussten auch, dass Journalisten damit trotz ihrer entgegenstehenden Grundrechte, die sich aus Artikel 5 des Grundgesetzes ableiten, Objekt der angeordneten Maßnahmen werden würden", sagt der Rechtsanwalt der taz, Johannes Eisenberg. "Wenn dies nicht beabsichtigt war, so wurde es zumindest in Kauf genommen. Insoweit besteht der Verdacht der Rechtsbeugung."



 von
von