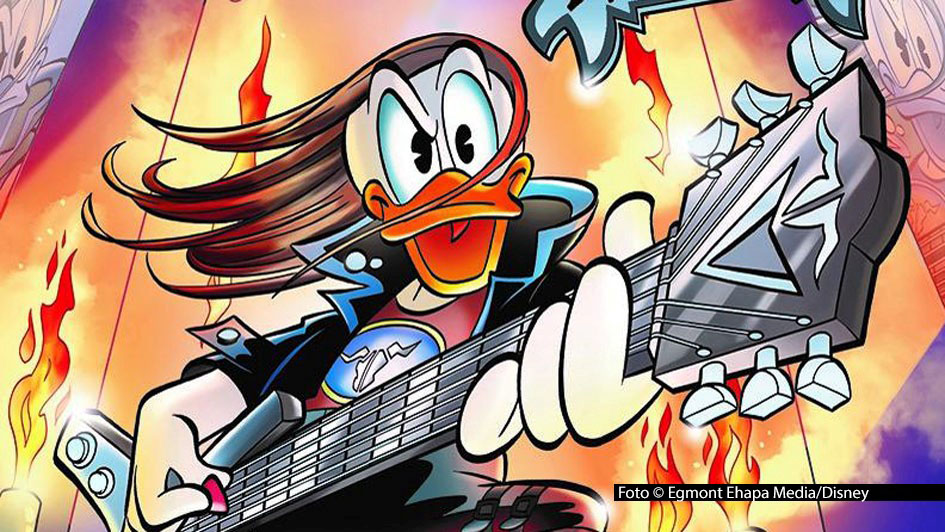Herr Schwochow, wenn ein Regisseur die neue Staffel einer erfolgreichen Serie wie „The Crown“ mitgestalten darf – legt er sich ins gemachte Nest oder baut ein ganz neues?
Durch den Erfolg der ersten zwei Staffeln von „The Crown“ war das Nest von Peter Morgan, einem der besten Drehbuchautoren der Welt, und seinem sehr eingespielten Team natürlich schon mehr oder weniger fertig gemacht.
Aber?
Der Qualitätsanspruch ist sehr hoch. Es geht bei jedem Arbeitsschritt um Perfektion. Und die erzielt man nicht, indem man sich auf Erfolgen ausruht, sondern durch unablässige Weiterentwicklung. Peter Morgan sucht nie Erfüllungsgehilfen, sondern Partner.
Innerhalb des historischen und dramaturgischen Korsetts gab es also kreative Freiräume?
Viele sogar. Nachdem wir intensiv über meine Folgen, das Casting, die Schauspieler geredet hatten, konnte ich auch mithilfe des Kameramanns, den ich selbst mitgebracht hatte, die Ästhetik erweitern. Uns war zwar klar, dass wir die Grammatik von „The Crown“ bedienen, aber trotzdem gab es viel Raum für meine Art zu erzählen. Es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, die Bildsprache und Inszenierungsweise in Frage zu stellen.
Warum nicht?
Weil wir dann womöglich genau das verändert hätten, was ich an der Serie so liebe. Insofern war die Erfüllung bestimmter Gesetze auch keine Bürde für mich.
Aber welche genau hat man sich denn vom deutschen Regisseur erhofft, der eine urbritische Institution darstellt?
Einen anderen Blick auf eine Monarchie vielleicht, die ihre Königin mit Privilegien überhäuft und gleichsam in einem Käfig gefangen hält. Für solche Freiheitsverluste bringe ich als Ostdeutscher, der in einer Diktatur groß geworden ist, womöglich eine besondere Sensibilität mit. Zum einen waren die Macher oft verblüfft über meine Sicht der Dinge, zum anderen haben sie ihre eigene auch dadurch erweitert, dass ich ständig Verständnisfragen zu Land und Leuten hatte. Das erweitert für alle den Horizont.
Man muss das Leben in einer Monarchie also gar nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben, um glaubhaft davon zu erzählen?
Nein, aber das gilt ganz grundsätzlich. Wenn man als Regisseur autobiografische Bezüge zur jeweiligen Arbeit bräuchte, könnte ich über viele Themen ja keine Filme machen. Vor „Bad Banks“ hatte ich schließlich auch nie irgendwas mit der Finanzbranche zu tun. Weil ich mich mit Haut und Haar hineingeworfen habe, ist aber trotzdem was dabei rausgekommen. Und das gilt hoffentlich auch für „The Crown“.
Umso mehr, als die Arbeitsbedingungen in England gewiss besser sind als hierzulande…
Sensationell sogar! Ich bin schon vier Monate vor Drehbeginn nach London gezogen, habe viel gelesen, Zeitzeugen getroffen, Experten befragt, fast schon journalistisch gearbeitet. Vor allem aber gab es eine Rechercheabteilung mit Topleuten, die alles wissen und falls nicht, alles herausfinden. Es war wie im Paradies.
Haben diese paradiesischen Zustände vor allem mit Geld zu tun, von dem pro Folge ja mehr investiert wurde als bei jeder Netflix-Serie zuvor?
Auch, klar. Schließlich wissen Netflix und Sony genau, dass man eine Serie im Buckingham Palace nicht mit gewöhnlichen Budgets erzählen kann. In England merkt man aber auch Projekten, die am Ende weit günstiger sind als „The Crown“, oft an, wie viel Personal, Zeit und Mittel bereits in die Drehbuchentwicklung gesteckt werden. Dieser Qualitätswahnsinn steht anders als bei uns über allem. Toll!
Aber nehmen Sie diesen Wahnsinn jetzt nicht mit in die nächste deutsche Produktion und machen ihr das Leben schwer?
Ich könnte mir schon vorstellen, bestimmte Qualitätskriterien an Personal und Material fortan deutlicher zu machen als zuvor. Aber meine Ansprüche waren diesbezüglich auch in Deutschland stets hoch, sie finden durch die Arbeit an „The Crown“ nur noch mehr Bestätigung. Auch wenn man hier nie ein solches Budget zusammenkriegt, könnte es also härter werden mit mir.
Mit so einem Referenzprojekt im Gepäck dürfte ihre Verhandlungsposition aber auch deutlich gestärkt sein.
Schon. Aber weil ich bereits durch die tolle Erfahrung mit „Bad Banks“ ein inhaltliches Level erreicht habe, unter dem ich nicht mehr arbeiten kann und will, wird es trotz der besseren Verhandlungsposition nicht leichter, Projekte zu finden, die auch nur annähernd so vielschichtig und so gut entwickelt sind wie „The Crown“.
Das dabei eher an „House of Cards“ als klassische Königshausserien erinnert. Geht es in der parlamentarischen Monarchie wirklich so intrigant zu?
Aus den Sechzigerjahren, die wir in dieser Staffel erzählen, leben jedenfalls noch genug Zeitzeugen, die das bestätigen. Natürlich sind, gerade was die Privatsphäre der Queen betrifft, oft Lücken mit Interpretation zu füllen. Aber wenn Sie die britische Politik von heute betrachten, wirkt „The Crown“ doch fast harmlos. Das Ausmaß boshafter Schlammschlachten ist damals wie heute also sehr realistisch.
Ist die Analogie zur Verrohung des Königreichs im Zuge des Brexit demnach gewollt?
Kalkül steckte zwar nicht dahinter, aber seit ich im Juli vier Monate nach dem Zuschlag für zwei Folgen nach London gekommen bin, machte jede Nachricht vom Brexit deutlicher, wie Geschichte sich doch wiederholt. Und als wir bemerkten, wie viel die Verschwörung um Lord Mountbatten, von der ich zuvor noch nie was gehört hatte, mit uns und unserer heutigen Zeit zu tun hat, haben wir natürlich nach Analogien von Vergangenheit und Gegenwart gesucht.
Eine der vornehmsten Aufgaben historischer Fiktion.
Genau. Auch um uns und dem Publikum zu ermöglichen, Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Verändert es die Arbeit, wenn historische Fiktion von lebendigen Personen handelt?
Es macht definitiv demütiger. Vor allem, was die Genauigkeit betrifft. Bei uns im Team arbeitet deshalb Major David, der 35 Jahre im Buckingham Palace für die Queen tätig war und fast alle Menschen in ihrem Umfeld kennengelernt hat. Durch ihn und andere Berater können wir sehr an der Realität erzählen. Olivia Colman standen wie allen anderen ein Movement- und Vocal-Coach zur Seite, mit dem sie bis ins Detail Gesten, Mimik, Sprache der Queen studiert hat. Obwohl viel Hollywood in „The Crown“ steckt, fühlt es sich daher sehr wahrhaftig an.
Aber kann Akribie nicht zu einer Verbissenheit führen, die der Erzählung schadet?
Im Gegenteil: je besser die Vorbereitung ist, desto freier kannst du erzählen. Und das gilt sogar für all jene Episoden und Begebenheiten, von denen selbst in England kaum jemand weiß – geschweige denn ich als Deutscher.
Ist es aus ihrer Sicht vorstellbar, dass jemand aus England umgekehrt ein Biopic über Nationalheiligtümer wie, sagen wir: Helmut Schmidt oder Thomas Gottschalk dreht?
(lacht) Also davon abgesehen, dass sich in England vermutlich keiner für Thomas Gottschalk interessiert, ist dieser Perspektivwechsel nicht nur denkbar, sondern überaus wünschenswert.
Welche Figur der Zeitgeschichte würde Sie persönlich denn interessieren?
Weil ich gerade zweimal historisch gearbeitet habe, würde mich zunächst mal eine frei erfunden der Gegenwart interessieren.
Schreiben Sie sich die im Zweifel selber oder warten lieber auf Angebote?
Witzigerweise entwickle ich da tatsächlich gerade selber etwas mit den Produzenten von „The Crown“.
Sagen aber vermutlich nicht, worum genau es sich dabei handelt.
Genau, sorry.
Herr Schwochow, vielen Dank für das Gespräch.
Die dritte Staffel von "The Crown" steht ab Sonntag bei Netflix zum Abruf bereit.



 von
von