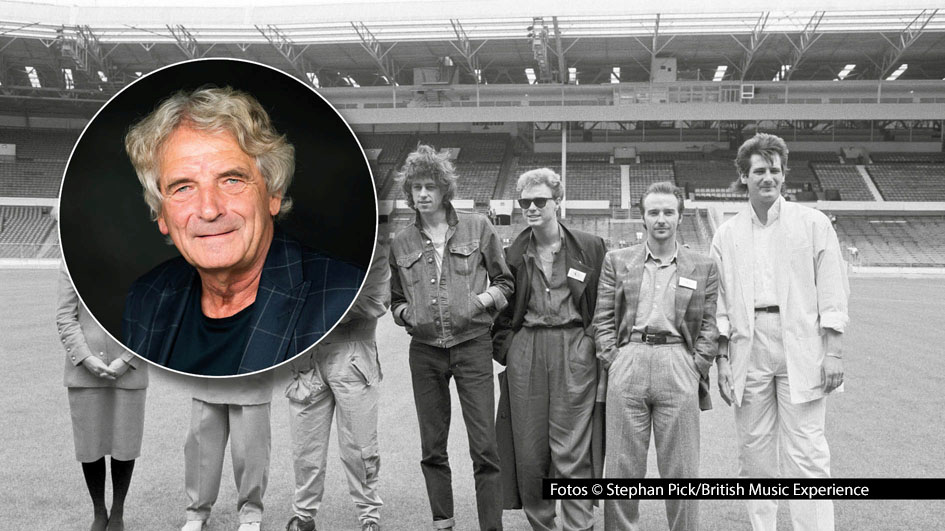Frau Petkovic, ist Tennisprofi ein Traumberuf?
Jein. Man muss eine gewisse Art Mensch dafür sein. Bei mir passt es, weil ich gerne reise und von Herausforderung zu Herausforderung lebe. Auf das tägliche Training könnte ich gerne verzichten, aber nicht auf den Wettkampf und die Reibung, die dabei entsteht. Für Menschen sanfteren Gemütes ist das nicht unbedingt etwas.
Gibt es Momente, in denen sie es verteufeln, als Profi immer möglichst perfekt sein zu müssen?
Bei den Trainingseinheiten empfinde ich das nicht als schlimm, weil ich mir da immer wieder einrede, dass ich dadurch im anstehenden Match besser funktioniere. Dieser Antrieb macht mir sogar Spaß. Das gilt auch für Auftritte auf großen Bühnen mit all den Menschen und Kameras. Was aber oft unterschätzt wird, ist diese Einsamkeit in Hotels. Man hat zwar seine Leute, mit denen man viel Zeit verbringt – die sind am Ende des Tages aber auch da, weil sie bezahlt werden. (lacht) Die letzten drei, vier Jahre meiner Karriere hatte ich dann aber auch Trainer, mit denen ich privat befreundet war. Das hilft.
Generell entstand der Eindruck, Sie wollten gerne der Tennis-Blase entfliehen. Sie haben eine Kolumne geschrieben und moderieren neuerdings sogar fürs Fernsehen.
Meine Eltern haben immer darauf bestanden, dass ich auch den zweiten Bildungsweg verfolge. Das gab dann gerne mal Zoff, weil ich nur Tennis und Turniere spielen wollte. Ihren Drang, mein Abi zu machen und studieren zu gehen, habe ich allerdings irgendwann derart verinnerlicht, dass ich nicht mehr einfach "nur" Tennis spielen konnte. Tennis ist körperlich zwar extrem anstrengend, intellektuell bleibt man aber gerne mal auf der Strecke. Deswegen habe ich angefangen zu schreiben. Über das Schreiben kamen dann auch andere Angebote, vom Fernsehen etc. Schreiben bleibt aber meine größte Leidenschaft – neben Tennis natürlich.
Haben Sie von Beginn an mit dem Ziel geschrieben, die Texte zu veröffentlichen?
Ich habe mit dem Schreiben begonnen, um mich mit mir selbst auf intellektueller Ebene auseinanderzusetzen. Irgendwann ist die Chefredakteurin des "racquet magazine" auf mich zugekommen und bot mir an, für sie zu schreiben. Ich wusste zunächst gar nicht, worüber. Anderthalb Jahre lang habe ich mich nicht gemeldet, bis ich das Buch "The Art of Rivalry" entdeckte, in dem es um Künstlerpaare geht – Picasso und Matisse beispielsweise. In dem Buch wird beschrieben, wie sie ihre Rivalität persönlich angestrengt hat, sie jedoch künstlerisch für den Durchbruch sorgte. Der eine hätte ohne den anderen wohl niemals diesen Erfolg gehabt. Während des Lesens musste ich immer wieder an Roger Federer und Rafael Nadal denken. Die beiden sind sich eigentlich total ähnlich, werden in den Medien aber oft sehr unterschiedlich dargestellt. Diese beiden Rivalitäten habe ich dann miteinander fürs "racquet magazine" verglichen. Das kam okay an (lacht) – und die Anfragen wurden mehr.
Irgendwann kam dann das ZDF.
Das ZDF hat mich zu einem Casting eingeladen, das ganz schrecklich lief. Sie haben mich aber wohl nochmal eingeladen, damit ich nicht traurig bin. (lacht) Mir ging es nie darum, eine Show zu moderieren – ich will nur die Geschichten des Sports erzählen, in welcher Form auch immer. Ich bin allerdings auch eine Person, die sich gnadenlos selbst überschätzt und neugierig auf neue Dinge ist. Mit dieser Wendung hatte ich dennoch nicht gerechnet.
Die meisten ehemaligen Sportler nehmen gerne die Expertenrolle ein. Kommt das für Sie nicht infrage?
Ich würde total gerne als Tennis-Expertin arbeiten. Leider zeigen wir beim ZDF nicht so viel Tennis. Das wäre also eher wenig Arbeit. (lacht)
Sie haben während Ihrer Karriere auch mit Mentalcoaches zusammengearbeitet. Hat das bei der Vorbereitung auf den TV-Job geholfen?
Im Sport sagen wir, "Performing under Pressure" macht man am besten in der rechten Gehirnhälfte – also dort, wo Kreativität und Instinkt zu finden sind, während die linke Gehirnhälfte Verstand und Ratio ist. Du trainierst in der Ratio, um vorbereitet zu sein, damit du dich im Ernstfall auf die rechte Gehirnhälfte verlassen kannst. Wenn du das schaffst, kommt alles automatisch. Das lässt sich erlernen, indem man viel meditiert und die Gedanken in einen leeren Raum "wegschiebt". Beim Tennis ist das beinahe das gleiche wie vor der Kamera. Nur, dass du hier natürlich noch Texte sprechen musst. Vom Gefühl her aber durchaus vergleichbar. Beides muss so natürlich wie möglich sein – leichter gesagt als getan. (lacht)
"Ich versuche, Sport als Teil der Gesellschaft zu präsentieren und eben nicht nur als Opium."
Andrea Petkovic
Ist es von Vorteil, dass Sie in der "Sportreportage" ohne Studiopublikum arbeiten müssen?
Es war nicht besser oder leichter, sondern komischer. Wenn ich im Stadion gewinne, jubeln die Leute und die Hormone drehen durch. Und wenn ich verliere, kommt die Enttäuschung. Nach meiner ersten Sendung hieß es dann einfach: "Das war's, danke, ciao". Dann sind alle nach Hause gegangen. Mein Gehirn war vollkommen verwirrt. Ich war nicht froh und auch nicht traurig. Das ist mit Publikum dann schon etwas cooler.
Im "Sportstudio" wäre das ja gegeben. Wäre das eine interessante Perspektive?
So weit denke ich im Moment nicht. Ich bewundere die Kollegen aus dem "Sportstudio", weil sie alles im Kopf haben müssen, alle Ergebnisse und Nachrichten. Die Gespräche, wenn du nicht weißt, ob sich dein Gegenüber öffnet. Bei uns in der "Sportreportage" finde ich schwierig, dass wir für Interviews zeitlich so begrenzt sind. Wenn nur zweieinhalb Minuten Zeit bleiben, dein Gesprächspartner aber zu ausschweifend antwortet, dann hast du kaum eine Chance, alles unterzubringen, was du dir vorgenommen hast. Das macht es kompliziert, Tiefgang zu finden.
Als Sportlerin haben Sie sicherlich Fragen im Kopf, die Sie niemals stellen möchten, weil Sie die schon zu Ihrer Zeit schon nervig fanden.
(lacht) Das mag schon stimmen. Als mir Dominic Thiem zugeschaltet wurde, habe ich den Redakteuren gesagt, dass ich taktische Fragen stellen möchte – darauf habe ich bestanden. Der Mann hat nach 770 Spielen 770 Mal die gleichen Fragen gehört. Wenn er jetzt ausnahmsweise mal nachdenken muss, dann werden die Antworten ja hoffentlich besser. So war's dann auch.
Sie interessieren sich nicht nur für Sport, sondern auch für Popkultur. Lässt sich das im Fernsehen miteinander vereinen?
Viele Themen werden immer im Zeitgeist besprochen und es wird darauf geachtet, was bestimmte popkulturelle Dinge für die Gesellschaft tun. Sport ist immer nur Opium fürs Volk, da gehen die Leute hin, wenn sie nicht nachdenken wollen. Dass das so gesehen wird, finde ich total schade, weil alle Sportler Dekaden an gelebten Werten und einen Glauben verkörpern. Meist den Glauben an sich selbst, wenn sonst niemand an einen glauben möchte. Das sind wichtige Eigenschaften, die eine Gesellschaft voranbringen können. Deswegen versuche ich Sport als Teil der Gesellschaft zu präsentieren und eben nicht nur als Opium.
Noch stehen Sie aber auch auf dem Platz. Wie sieht Ihr weiterer persönlicher Fahrplan aus?
Dieses Jahr sollte eigentlich mein Ausklingjahr werden. Jetzt habe ich mich verletzt, weshalb ich das erste Drittel der Saison direkt mal verpassen werde. In jedem Fall werde ich aber weniger Turniere spielen, meinen Knorpelschäden an den Knien zuliebe. Dennoch ist Tennis immer noch mein Leben und ich will das noch so lange machen, wie es körperlich geht. Zwischendurch immer mal wieder etwas fürs Fernsehen – und dann schauen wir mal, wohin die Reise noch gehen wird.
Frau Petkovic, vielen Dank für das Gespräch.



 von
von