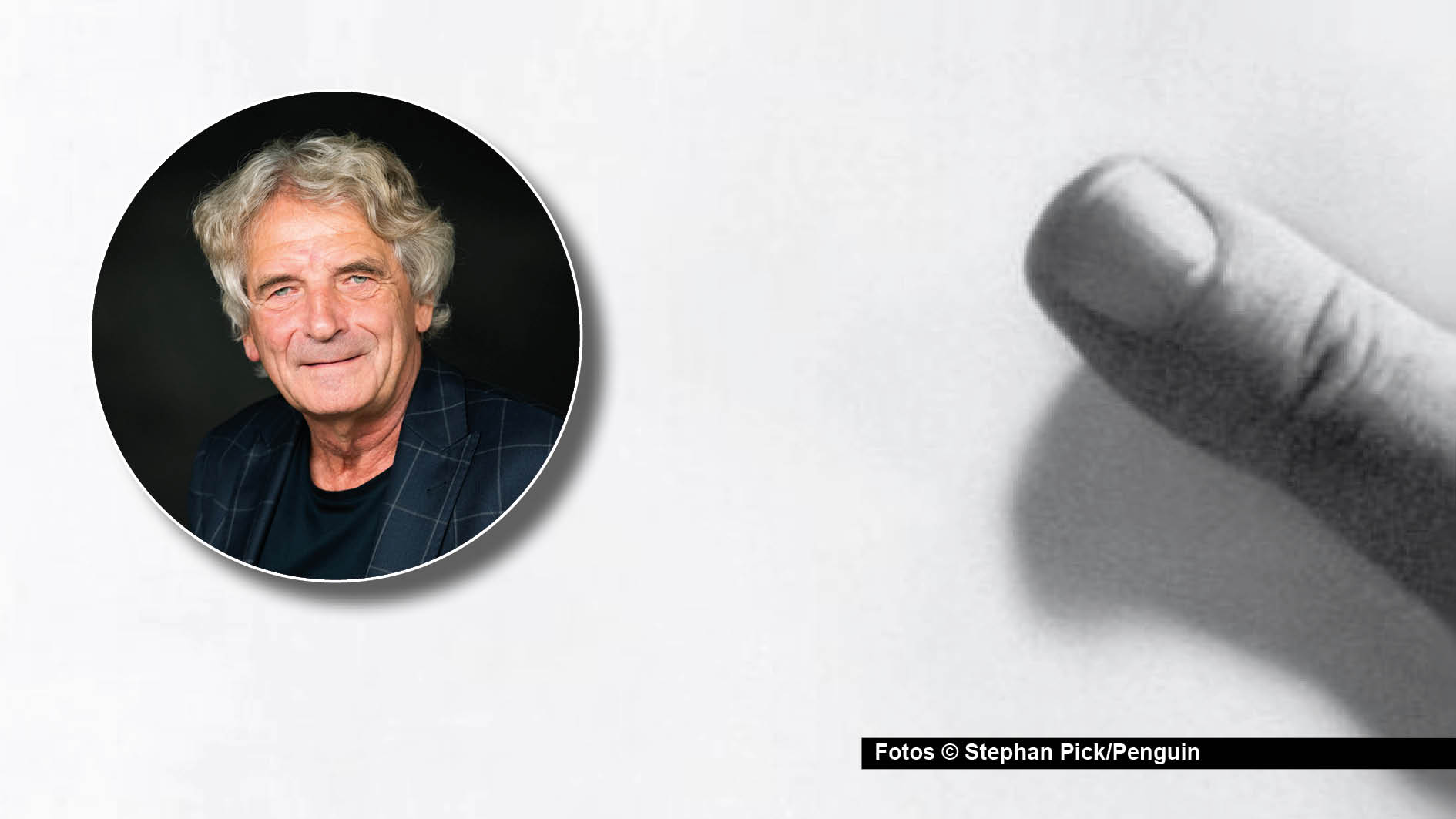Was ist nun leider tatsächlich eingetreten?
Vor etwa zwei Monaten schrieb ich hier zur Prognose-Anpassung von ProSiebenSat.1: "(…) wenn sich RTL nicht in einem anderen Werbemarkt befindet, als seine Wettbewerber, würde ich sagen, das Guidance-Risiko ist auch dort hoch. Ich hoffe, ich irre mich." Nun senkt die RTL Group nach den Q3-Zahlen 2025 ihren Ausblick für Umsatz und Ergebnis (EBITA 2025 jetzt 650 Millionen statt 780 Millionen Euro, Umsatz 6,0–6,1 statt 6,45 Milliarden Euro), weil die TV-Werbung in Deutschland und Frankreich deutlich schwächer bleibt als erwartet. Der Werbemarkt hat sich also im zweiten Halbjahr nicht - wie bis zuletzt offensichtlich gehofft - erholt, sondern weiter verschlechtert. Gleichzeitig läuft Streaming besser als geplant und nähert sich der Profitabilität. Parallel bereitet RTL den Sky-Deutschland-Deal und einen CEO-Wechsel vor – beides passiert jetzt vor einem deutlich härteren Werbe-Setup. Der Kapitalmarkt hat die neuen Zahlen und den gesenkten Ausblick klar negativ quittiert, am Ende fast – 6 % auf Tagessicht und sieht einen Dämpfer fürs klassische RTL-Equity-Narrativ "Werbemarkt dreht, Streaming wächst", ohne dass die Story komplett bricht, aber eben mit einem spürbaren Reality-Check. RTL selbst betont weiter den Shift von linear zu Streaming, gleichzeitig wachse digitale Werbung stark. Aber: Selbst +31,7 % Digital reichen nicht, um den TV-Einbruch aufzufangen. Das spricht eher für einen strukturellen Druck auf klassische Spot-Werbung, nicht nur für eine Konjunkturdelle. Und nun? Bei ProSiebenSat.1 hatte die Gewinnwarnung mutmaßlich auch zur Auswechslung des Gesamtvorstands beigetragen, so dass nun viel Italienisch von gut gekleideten Herren auf den Gängen gesprochen wird. Bertelsmann/RTL hat dagegen unlängst die Nachfolge von Thomas Rabe als Bertelsmann CEO und RTL Group-Chef bekannt gegeben. Ich denke auf Thomas Coesfeld (Bertelsmann CEO und Chairman ab Januar 2027) und Clément Schwebig (RTL Group CEO ab Mai 2026) werden anspruchsvolle Führungsaufgaben zukommen. Wenn der systemisch-strukturelle Werbedruck nicht nachlässt, kann eigentlich nicht alles so bleiben, wie es ist.
Was ist nun entschieden und verändert vieles?
Die Champions League hat neue Rechteinhaber und einen alten Gewinner: die UEFA. Hinter ihr arbeitet jetzt UC3, das gemeinsame Commercial-Vehicle von UEFA und Klubverbänden, das mit der US-Agentur Relevent die TV-, Streaming- und Sponsoreinnahmen maximiert. Ein globales Rights-Powerhouse verkauft also europäischen Fußball an die Plattform, die am tiefsten in die Tasche greift. Für deutsche Fans fühlt sich das Ergebnis an wie ein Pay-Abo-Sudoku: Bundesliga weiter bei Sky und DAZN, die Königsklasse künftig vor allem bei Paramount+, das Topspiel bei Amazon, Europa League und Conference League bei DAZN. Und je nach Final-Konstellation womöglich auch noch Netflix plus Free-TV. In Großbritannien ein ähnliches Bild: Paramount+ als Hauptanbieter, Amazon mit dem Dienstag-Topspiel, Sky mit Europa- und Conference League, BBC mit Highlights. Wer "einfach nur alles sehen" will, braucht keinen TV-Guide mehr, sondern eine Excel-Tabelle. Mit dem Multi-Markt-Deal sendet vor allem Paramount+ ein strategisches Signal. Die Plattform nutzt Premium-Fußball nicht als nettes Add-on, sondern als Turbo, um sich in Europa überhaupt erst als ernstzunehmender Streaming-Player neben Netflix, Disney+ und Amazon ins Relevant-Set der Nutzer zu schießen. Und sonst? Der Kontrast zu Frankreich und Spanien könnte kaum größer sein. Dort bleibt das Modell erstaunlich klassisch. In Frankreich bündelt Canal+ praktisch alle europäischen Klubwettbewerbe, in Spanien liegt alles bei Movistar (Telefónica). Ein Anbieter, ein Abo, ein zentraler Erzählort. Für DAZN bedeutet die neue Rechtewelt: weniger Königsklassen-Glanz, mehr "Haus des Fußballs". National starke Ligen, dazu in Deutschland Europa League und Conference League und europaweit eher die Rolle des Volume-Players als des Exklusiv-Hero. Das kann ein solides Geschäftsmodell sein, aber es ist eben nicht mehr der große CL-Angriff auf die klassischen Pay-TV-Marken oder Streamer. RTL trifft der Verlust der Europa League dagegen mitten ins Herz. Die Donnerstagsabende haben Sender und RTL+ über Jahre liebevoll als Sportmarke aufgeladen. Weg ist nicht nur ein Wettbewerb, weg ist ein Ritual, das Quote, Image und möglicherweise Abo-Argument zugleich war. Das muss der Sender jetzt mit noch mehr Entertainment- und Fiction-Peaks oder anderen Sportrechten kompensieren. Unterm Strich bleibt: Die UEFA ist die große Gewinnerin dieses aggressiven Bieterverfahrens. UC3 und Relevent haben mehr Geld aus dem Markt gepresst. Bezahlt wird in Abos, Fragmentierung und Verwirrung. Für UEFA/Klubs ist das lukrativ, für die Anbieter teuer. Für Fans ist es vor allem eins: ein Belastungstest für ihre Liebe zur Königsklasse.
Wie geht es mit einem Paragrafen im Medienstaatsvertrag weiter?
Zuletzt hat nun auch der Brandenburger Landtag sein OK gegeben. Mit der Reform von ARD, ZDF und Deutschlandfunk war dieses Jahr ein Paragraph ins Rampenlicht gerückt, der viele Hoffnungen geweckt und mindestens so viele Missverständnisse erzeugt hatte: § 30d Abs. 2 MStV. Dort heißt es, zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags "sollen" ARD, ZDF und Deutschlandradio mit privaten Veranstaltern zusammenarbeiten; Kooperationen können "insbesondere eine Verlinkung (Embedding) oder sonstige Vernetzung öffentlich-rechtlicher Inhalte oder Angebote, vereinfachte Verfahren der Zurverfügungstellung […] oder die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen beinhalten". Für Joyn, RTL+ & Co. klang das erst einmal wie die gesetzliche Einladung, sich die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen in die eigene Oberfläche zu holen (zur Erinnerung, das hatte Joyn Anfang des Jahres gemacht). Genau hier ziehen Juristen und Gerichte aber die Linie. Würde man daraus einen Anspruch der Privaten basteln, wären Programmfreiheit und Selbstverwaltungsautonomie der Anstalten nachhaltig beschädigt, und damit die rundfunkverfassungsrechtliche Statik. Deshalb schließen die Begründungen genau diese Lesart ausdrücklich aus. "Sollen zusammenarbeiten" heißt: ernsthaft prüfen, wo Kooperation dem Auftrag dient, nicht: alles, was private Plattformen wollen, wird automatisch durchgewinkt. Der Joyn-Fall bleibt wohl die Nagelprobe. Wird ProSiebenSat.1 versuchen, § 30d in den Instanzenzug hineinzutragen (und welche Rolle spielt dies unter dem neuen Management überhaupt? Laufen die bilateralen Gespräche noch?)? ARD und ZDF werden mit Verfassungsrecht antworten. Kooperation ja, aber nur dort, wo sie der Versorgung des Publikums dient, und nicht als automatisches Lieferrecht für Plattformbetreiber. Meine Lesart als Nicht-Jurist: § 30d zielt eher auf den Versorgungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen und nicht auf Rechtsansprüche privater Streamer. Die Öffentlich-Rechtlichen bleiben klar in der Verantwortung, ihren Auftrag plattformübergreifend zu erfüllen. Und die Privaten bleiben in der Pflicht, um Kooperationen zu werben, statt sie aus Paragraphen herauszulesen. Ich hoffe, dass weitere kluge und vernunftbegabte Verhandlungen zwischen den Systemen die Zukunft prägen. Und bin gespannt, was nun folgt, da das Gesetz in Kraft tritt.
Welchen Bericht fand ich spannend?
Frankreich hat jetzt schwarz auf weiß, wie sehr seine vielzitierte "exception culturelle", also das französische Schutzsystem für heimische Filme und Serien, inzwischen auf US-Geld baut. Der neue Arcom-Bericht (Medien- und Regulierungsbehörde Frankreichs) für 2024 weist 1,61 Milliarden Euro verpflichtende Investitionen in französische Produktionen aus, ein Plus von 1,5 Prozent. Das Wachstum kommt ausschließlich von den Plattformen: 397 Millionen Euro, plus 18 Prozent. Die linearen Sender fahren ihre Beiträge erstmals leicht zurück (–3 Prozent), bleiben mit rund drei Vierteln zwar Hauptfinanzier, verlieren aber sichtbar an Zugkraft. An der Spitze steht Netflix: 220 Millionen Euro für französische Serien und Shows, plus 26 Prozent – das sind 69 Prozent aller Plattform-Mittel und 19 Prozent aller Ausgaben insgesamt. Im Kino dominiert zwar weiter Canal+, doch auch hier ist Netflix der wichtigste Streaming-Finanzier französischer Filme. Auf dem Papier funktioniert das System: rund 20 Prozent Umsatzpflicht, 93 Prozent der Investitionen in französischsprachige Originale, 85 Prozent in Erstausstrahlungen, 73 Prozent in unabhängige Produzenten. Kulturpolitisch bleibt die IP in Frankreich, industriepolitisch wandert ein Teil der Drehtage und Wertschöpfung aber trotzdem ins Ausland. Der Arcom-Bericht ist damit beides: Erfolgsbilanz und Warnsignal. Frankreich sichert ein hohes Produktionsvolumen ab, in einer Phase, in der klassische Sender schwächeln. Gleichzeitig macht sich das Land strukturell abhängig von der Investitionslaune börsennotierter US-Konzerne. Die "exception culturelle" lebt, wird aber zunehmend von denen mitfinanziert, vor denen sie ursprünglich schützen sollte.
Und über welche Kinofilm-Kampagne habe ich sehr gelacht?
Timothée Chalamet verkauft seinen neuen Film "Marty Supreme" mit einem Anti-Werbespot, einem 18-minütigen Zoom-Call, in dem am Anfang gefühlt nichts passiert. Smalltalk, Tonprobleme, falscher Screen-Share, alles so trocken inszeniert, dass es weh tut. Und gerade deshalb ist es brillant. Statt Hochglanz-Trailer sehen wir einen Marketing-Call, wie es sie viele gibt: ein Star monologisiert, ein Team nickt. Chalamet spielt den überkreativen "Internal Marketing Guy", der sich in eigenen Buzzwords verliert. Er "fruitionized" die Kampagne, spricht von "culmination" und "integration", will Marty auf der Wheaties-Packung, einen "Blimp" (Luftschiff), der Ping-Pong-Bälle regnen lässt, die Freiheitsstatue und den Eiffelturm in Hardcore-Orange. Zwischendurch wagen ein, zwei Leute höfliche Bedenken – zu gefährlich, zu wild, zu teuer – und werden in Sekunden wieder plattgemacht. Man spürt die Cringe-Spannung im Call. Alle wissen, dass das BS ist, aber niemand traut sich, dem Star wirklich zu widersprechen. Für die Zweifler, glaubt mir, es gibt genau solche Meetings, ich war in zig davon. Das eigentlich Spannende: Diese Kampagne durchdringt die Kultur, obwohl sie jeder Mobile-Logik widerspricht. 18 Minuten Laufzeit, horizontales Bild, kein schneller Hook, die ersten Minuten "passiert" nichts. Und doch sprechen Marketer, Medien und Memes darüber. Der Spot ist Werbung für einen Film und gleichzeitig eine schonungslose Satire auf unser eigenes Meeting-Theater. Mein Take: Wenn eine Idee so nah an einer gelebten Wahrheit und so konsequent im Format gedacht ist, darf sie alle Regeln brechen. Dann reicht ein einziger Zoom-Call, um mehr Wirkung zu entfalten als der schönste Trailer.



 Kommentar von
Kommentar von