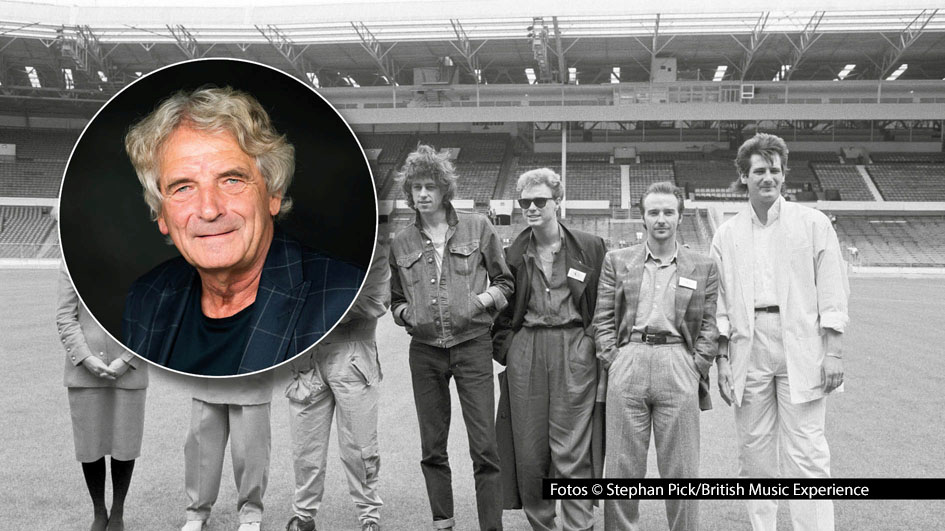Wie viel Gefühl ein echter Cowboy zeigen darf, beantworten Film & Fernsehen seit schwarzweißen Westernzeiten ziemlich genau: Null. Echte Cowboys reiten stumm durchs weite Land und reden selbst dann nicht viel, wenn sie gemeinsam am Lagerfeuer zum Sternenzelt blicken. Echte Cowboys lachen auch nur selten, weinen fast nie und wenn jemand stirbt, reiten sie einfach weiter. Echte Cowboys sind also ungefähr das Gegenteil von John Dutton, weshalb sich die Frage stellt, ob er ein echter Cowboy ist, und falls ja, was „Yellowstone“ bei all den Tränen, die John Dutton vergießt, den Gesprächen, die er hat, den Gefühlen, die ihm entfahren, überhaupt ein Western ist.
Die Antwort lautet unzweideutig: ja. Und was für einer! Wenn Sony AXN das sensationell erfolgreiche Paramount-Epos zum Start der dritten Staffel komplett nach Deutschland holt, läuft nämlich nicht nur eine Westernserie mehr, sondern die vielleicht beste überhaupt. Was zu großen Teilen am Hauptdarsteller liegt, doch dazu später mehr. Hier zunächst mal der Inhalt: Seit Generationen befindet sich Amerikas größte Privatfarm, benannt nach dem angrenzenden Nationalpark, im Besitz der Duttons. Wie seine Vorväter treibt auch ihr Nachkomme John das Vieh durch die majestätischen Berge Montanas und trotzt den Verwerfungen der Gegenwart. Noch.
Denn die Zivilisation rückt näher, unaufhaltsam. Während aufsässigen Umweltschützern schon die klimavernichtende Viehzucht der Duttons zu viel davon ist, planen Baukonzerne das menschenleere Tal gar ganz zu asphaltieren. Auch Hedgefonds trachten der Idylle nach Ausbeutung, während benachbarte Ureinwohner das Land ihrer Ahnen zurückfordern. Und dann wären da noch John Duttons vier Kinder, von denen sich drei so vom Bauernethos entfremdet haben, dass Blut doch dünner zu sein scheint als das kostbare Wasser der Prärie. Im Schwitzkasten der Gegenwart ist es daher kein Wunder, wenn alternde Cowboys wie John Dutton gnadenlos gegen sich und andere sind.
Nachdem er seinem schwer verletzten Pferd zu Beginn des Pilotfilms in aller Sachlichkeit den Gnadenschuss gibt, näht der Patriarch die Unfallwunde am eigenen Kopf folglich selber und geht auch sonst keinem Schmerz aus dem Weg, um „Yellowstone“ vor dem zu schützen, was er als Feinde betrachtet. Feinde allerdings, die im Angesicht des grassierenden Raubtierkapitalismus täglich mehr werden. Als sein treuester Sohn Lee im Kampf mit den Bewohnern des angrenzenden Indianerreservats erschossen wird, schließt Papa John beim Begräbnis deshalb die Reihen einer dynastischen Konterrevolution.
Shakespearesches Drama für Naturfilm- und Thrillerfans
Der politisch ambitionierte Familienanwalt Jamie (Wes Bentley), die manipulative Finanzmanagerin Beth (Kelly Reilly), das naturverbundene Nesthäkchen Kayce (Luke Grimes) – grundverschieden, aber geschwisterlich vereint, folgen sie ihrem Vater und seinem grenzenlos loyalen Vorarbeiter Rip (Cole Hauser) in die Schlacht ums Erbe. Und wie Kevin Costner den nostalgischen Pragmatiker mit entschlossener Selbstkontrolle versieht, wie der gedämpfte Zorn mit seiner inneren Ruhe um Deutungshoheit ringt, wie er zum literarischen Hybrid zwischen J.R. Ewing und Thomas Buddenbrook wird – das ist schlichtweg brillant.
Und es sorgt dafür, dass „Yellowstone“ trotz aller Gewalt, unzähliger Morde und Intrigen, trotz wechselseitiger Abscheu und wachsender Geringschätzung zusehends entfremdeter Landsleute eine Art von Wärme ausstrahlt, die mit der dauernden Reiterei durch Landschaften zum Niederknien plus Camping am nächtlichen Lagerfeuer, Wolfsgeheul inklusive, nur unzureichend erklärt wäre. Im Flackern der Flammen jedenfalls bricht jedenfalls auch die neue Staffel daheim Quotenrekorde und wühlt das Publikum soziokulturell auf wie zuletzt „House of Cards“. Grund dafür ist das Drehbuch von Showrunner Taylor Sheridan, der die Degeneration des amerikanischen Traums individualistischer Eintracht furios zum Trauma nationaler Zwietracht verdichtet und dafür einen denkbar genialen Schauplatz findet.
Denn im erzkonservativen, männerdominierten Farmerstaat Montana prallt Moderne so heftig auf Tradition, als führe Donald Trump selber Regie. Zugleich aber pulverisiert Sheridan, der die Abwehrschlacht alter weißer Cowboys schon im Neowestern „Hell or High Water“ zur Perfektion trieb, akribisch provinzielle Klischees. Native Americans wie Chief Rainwater (Gil Birmingham) sind im Clash of Civiliziations rüdere Kapitalisten als die Nachfahren der Invasoren, während den Weg des aasigen Investors Beck (Neal McDonough) weit weniger Leichen pflastern als jenen von John Dutton, der sein Personal aus Kriminellen rekrutiert und sodann brandmarken lässt, als wären sie Rinder.
Wenn die abgebrühte Trinkerin Beth einen Verehrer mit den Worten abweist, „Stadtjungs sind zu weich, um hart zu ficken“, bricht „Yellowstone“ zudem mit Geschlechterrollen, die auch der ehrgeizigen Gouverneurin Perry (Wendy Moniz) zu eng sind. Ohne erhobenen Zeigefinger hält Sheridans Sittengemälde Republikanern und Demokraten, Trumpisten oder Liberalen, Rechten wie Linken also gleichermaßen den Spiegel ihrer Scheuklappenmentalität vor. Resultat ist ein shakespearesches Drama für Naturfilm- und Thrillerfans. Mit John Dutton als King Lear, der zu jung ist, sein Reich aufzuteilen, aber alt genug für Verlustängste. Das kontrollierte Gefühlschaos, mit dem ihn Kevin Costner versieht, mag für Cowboys untypisch sein; es zeigt einmal mehr, warum dieses Genre einfach nicht totzukriegen ist.
"Yellowstone" läuft dienstags um 21:10 Uhr bei Sony AXN.



 TV-Kritik von
TV-Kritik von