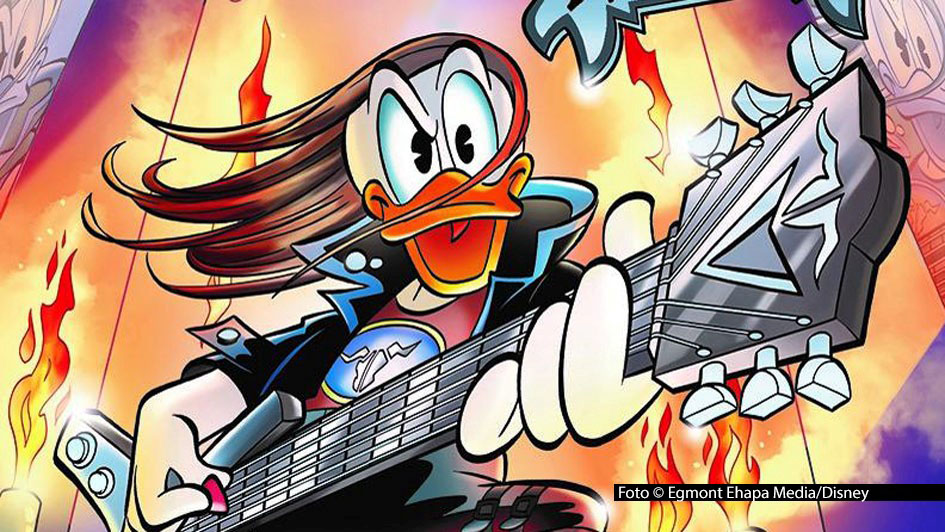Das Fernsehen ist seit schwarzweißer Zeit voller Hochstapler. Es gibt die großen und die kleinen, die charmanten und die schamlosen, die echten und die falschen, die Krulls und Madoffs, die Kujaus und Lupins. Mit Anna Sorokin gab es zuletzt zwar eine Frau im Betrugszirkus Maximus; meist aber sind es doch Männer, die publikumswirksam betrügen. Auf Helene hat das Fernsehen daher lange gewartet. Zu lange. Weshalb ihm das Streaming abermals zuvorkommt und der sehenswertesten Hochstaplerin seit Erfindung der Täuschung die Bühne bereitet.
Also Vorhang auf für Hell. Besser: Oh Hell! Da das Fake-Leben dieser Fake-Studentin mit Fake-Freunden und Fake-Jobs bei der Anrede stets unausgesprochen Ausrufe des Erstaunens vor sich zieht, sind Serientitel und Hauptfigur ab heute bei Magenta TV quasi deckungsgleich. (Oh) Hell Sternberg, 24 Jahre alt und auf der Karriereleiter noch deutlich unterhalb der ersten Sprosse, ist nämlich ein autobiografisches Desaster, dem die fabelhafte Mala Emde ein gleichermaßen naives wie abgebrühtes Gesicht verleiht.
Denn anders als Papa Günter (Knut Berger) glaubt, sitzt sie Mitte der zweiten von vorerst acht Folgen keineswegs im Audimax, um ihr Staatsexamen abzuholen, sondern im Call-Center, um Gartenartikel zu verkaufen. Und so geht es weiter. Immer weiter. Angefangen bei Rückblenden zur pubertären Gymnasiastin (Romi Pauline Dörlitz), die wegen fortgesetzten Schwänzens beim Psychologen (Roland Bonjour) ist, dort aber das Liebesleben ihrer Eltern („Ich gehe wieder zur Schule, wenn meine Eltern wieder richtig saftigen Geschlechtsverkehr haben, mit dem Penis in der Scheide“) kitten will und sich zur manipulativen Lügnerin ausbildet.
Nichts an Oh Hell, das wird mit jeder von jeweils 25 Minuten pro Episode offensichtlicher, entspricht den Erwartungen anderer, also: aller. Aber „das Tolle, wenn du immer verkackst“, beteuert sie mit gefälschtem Zeugnis auf dem Weg zur eigenen Abschlussfeier, für die ihr Vater überraschend seine Dienstreise absagt: „Du bist unglaublich gut darin, das Verkacken zu vertuschen“. Und so hangelt sich „Oh Hell“ vom Verkacken zum Vertuschen zum Verkacken zum Vertuschen und wieder zurück. Nur: wen sie mehr betrügt, lässt der frühere Journalist Johannes Boss auf ähnlich brillante Art offen, wie in seiner fabelhaften Männlichkeitsstudie „Jerks“, bei der er bis zur vierten Staffel Autor war.
Mit Dialogen nahe Monty Python und einer Bildsprache Richtung Wes Anderson, also einer realsatirischen Portion Aberwitz, die hierzulande selten ist, zeichnen die Drehbücher des Showrunners nicht nur das tragikomische Bild einer zwanghaften (Selbst-)Betrügerin. Simon Ostermann und Lisa Miller machen daraus ein entwaffnend lustiges Lehrstück über die Mechanik unserer hochglanzpolierten Aufmerksamkeitsgesellschaft, an der grobkörnige Freigeister wie dieser halt traurig oder fröhlich scheitern. Hell entscheidet sich für letzteres. Was für ein Glück.
Während das strahlende Rolemodel Maike (Salka Weber) schon in der Geburtsklinik besser aussah, täglich ein paar Tausend Insta-Follower zwischen sich und ihre Krippenfreundin legt, reihenweise Weltverbesserungsstart-ups hat und einen Freund zum Niederknien, kultiviert Oh Hell mangelnden Geschmack mit Ramschware, plant ein Losergram mit Don’t Likes für Menschen ohne Stil, Freunde und Einfluss, lebt so mittel- wie ideenlos in den Tag hinein und sucht in Laternenpfahlannoncen Anschluss, den sie im dritten Teil sogar findet.
Der schüchterne Musiklehrer Oskar (furios: Edin Hasanovic), dem sie (natürlich) vorlügt, Cello-Virtuosin ohne Praxis zu sein, entdeckt an seiner neuen Schülerin etwas, das sonst niemand in ihr sieht. Und so wird aus dem bizarren Psychogramm nebenbei die aktuell wohl schönste Lovestory im Serienfernsehen von heute – auch, weil zu keinem Zeitpunkt klar wird, ob Helene alias Oh Hell sich das alles nur einbildet oder wirklich erlebt. Und genau hierin liegt die eigentliche Kunst von Johannes Boss, der alle Fragen nach wahr oder falsch im Ungefähren lässt, also Interpretationsspielräume statt Filterblasen öffnet. Was Helene niemals träumt, ist nämlich eine Aufrichtigkeit, die der bürgerliche Kontrollwahn schon vor den sozialen Netzwerken als übergriffig empfunden hat.
Aus seiner Sicht versagt Helene pädagogisch, als sie der siebenjährigen Madlen (Rosa Löwe) im Kindergarten „wenn du später kiffst, achte auf die richtige Musik“ oder „fuck the system and create your own“ mit auf den Weg gibt, aber Kindern, die sie mobben, „noch eine dumme Bemerkung, dann wacht ihr morgen auf und habt Krebs“. Aus humanistischer Sicht begegnet sie Kindern damit auf Augenhöhe. Ob „Oh Hell“ sich selbst betrügt oder andere, ob hier überhaupt irgendwer betrogen wird oder doch nur zur Aufrichtigkeit animiert – das überlässt Boss demnach uns, dem Publikum.
Es gelingt ihm auch mithilfe der Hintergrundmusik von Daniel Strohhäcker und Felix Raffel blendend, die ein wenig so klingt, als hätten Bach und Buxtehude den Soundtrack von Clockwork Orange auf Ketamin im Kinderkarussell komponiert. Er untermalt eine meist brüllend komische, gelegentlich melancholische Figur, die in uns allen steckt, aber von den Konventionen einer ordnungsliebenden Selbstoptimierungsgesellschaft partout nicht rausgelassen wird. „Wenn die Welt eine Vernissage wäre, wärst du ein tolles Exponat“, sagt die Callcenter-Chefin zu Hell, die nach zwei Wochen nur einen Kaktus verkauft hat, weil sie am Telefon halt lieber quatscht als belabert. „Ist sie aber leider nicht“. Schade eigentlich.



 TV-Kritik von
TV-Kritik von