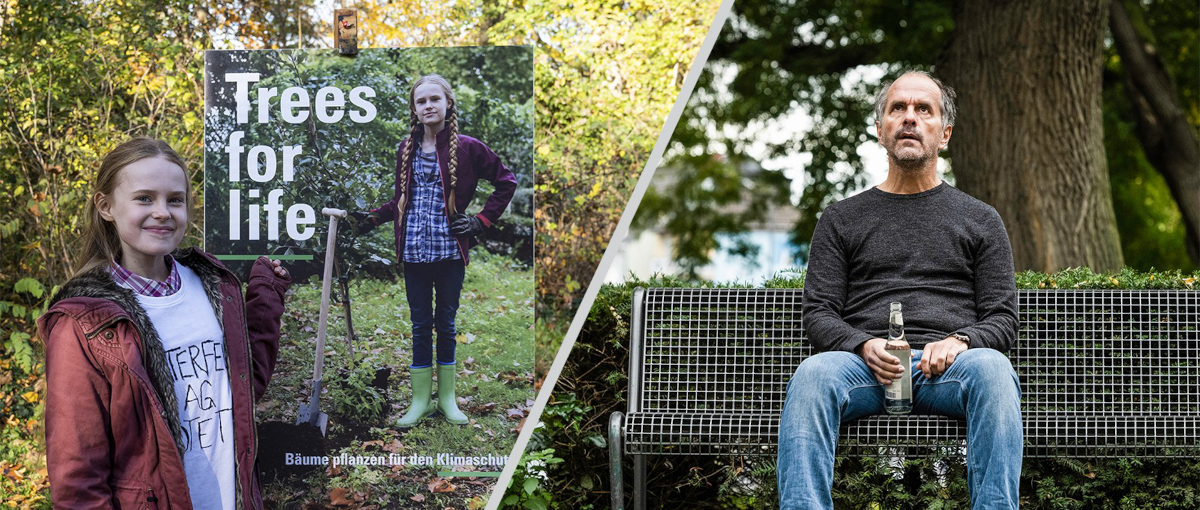Manchmal übertreiben sie, die Drehbuchautoren, Filmproduzenten und Regisseure. Sie meinen dann, in einem Film alle Probleme dieser Welt ansprechen zu müssen. Sie haben ein hehres Ziel. Sie wollen nicht nur unterhalten, sie wollen auch etwas aussagen, vielleicht sogar etwas verändern. Aber zu leicht verheben sie sich an der schieren Masse ihrer Botschaft, am übermächtigen Wollen, und zum Schluss bleibt von allem zu wenig.
Wie bei diesem Berliner „Tatort“, der nicht unbedingt ein schlechter ist, dem man aber ansieht, dass er noch drei Stufen besser sein könnte, hätte er sich selbst auf thematische Diät gesetzt. So aber geht es um Gewalt im öffentlichen Raum, um Zivilcourage, um das Für und Wider von Überwachung, um vorschnelle Urteile, um sensationsgeile Boulevardmedien und um verräterische Polizisten.
Man rechnet ja nicht mit viel, wenn die Kommissare Ritter und Stark in Berlin ermitteln. Zu oft schon haben sie das qualitative Schlusslicht in der „Tatort“-Riege gehalten und standen im Verdacht nicht nur für die Leiche am Anfang, sondern auch für die Beinahetötung des Zuschauers durch eine 90minütige Langeweileattacke zu sorgen.
Nicht so in diesem Fall, bei dem Stephan Wagner („In Sachen Kaminski“) für Buch und Regie gesorgt hat. Wagner ist ein Guter, und so fällt gleich auf, dass Ritter und Stark weitaus weniger dumm gucken als man es von ihnen gewohnt ist. Sie stellen auch viel weniger dumme Fragen, obwohl sie genau das doch so gut können. Wagner stellt die Kommissare quasi an den Rand und erzählt die Geschichte als Puzzle, dessen Teile sich mit zunehmender Sendedauer zueinander fügen.
Es geht um den Tod eines Mannes, der sich in der U-Bahn eingemischt hat, als zwei Jugendliche einem Gehbehinderten die Krücke klauen wollten. Kurz danach wird er tot auf dem Bahnsteig gefunden. Es beginnt das übliche Suchen nach Spuren. Stück für Stück wird zusammengetragen, was klein wirkt, was aber in der Summe durchaus ein Großes ergibt.
Wagner stellt dem Zuschauer wie nebenbei die Frage, ob er sich auch eingemischt hätte, ob er auch Position bezogen hätte gegen die übergriffigen Jugendlichen. In der Folge lässt er seine Polzisten technisch auffahren, was aufzufahren ist. Ritter und Stark sammeln im Lagezentrum die Bilder von Überwachungskameras, addieren ihre Erkenntnisse zu den Zeugenaussagen und holen sich dann noch die Handydaten. Sie werten Fotos von Smartphones aus, sie stöbern in Anrufbeantwortern und knüpfen aus dem Gefundenen ein Netz von Erkenntnis. In jedem ihrer Schritte liegt dabei eine Logik. Die Abfrage von Daten ist dementsprechend kein Problem, sondern das Gebot der Stunde.
Das führt auf dünnes Eis, weil solch eine erfolgreich geflochtene Kette von Daten durchaus auch als Rechtfertigung für allgegenwärtige Überwachung dienen könnte. Eh man sich versieht, ist man für die Big-Brother-Methoden, die man gestern noch so vehement bekämpfte.
Dazu führt Wagner die Zuschauer auf falsche Fährten. Er entlarvt schnelle Urteile und zeigt, warum der Böse nicht immer der Böse ist, warum die klaren Antworten längst nicht so klar sind wie sie auf den ersten Blick scheinen. Natürlich hat er sich bei bekannten Beispielen bedient, und natürlich kriegen auch die sensationsgeilen Medien, die aus dem Opfer schneller einen Helden machen als es angebracht wäre, ihr Fett weg.
Am Ende gibt es eine Lösung, die so zwingend wie überraschend ist. Aber das Ende ist nicht das Ziel. Es geht um den Weg dorthin. Den schmückt Wagner mit dichten Bildern, mit passendem Schnitt und modernem Licht.
Und die Kommissare? Sie sind da, aber nicht wirklich wichtig. Sie stören nicht weiter. Das ist in Anbetracht ihrer bisherigen Leistungen schon ein riesengroßer Fortschritt.



 von
von