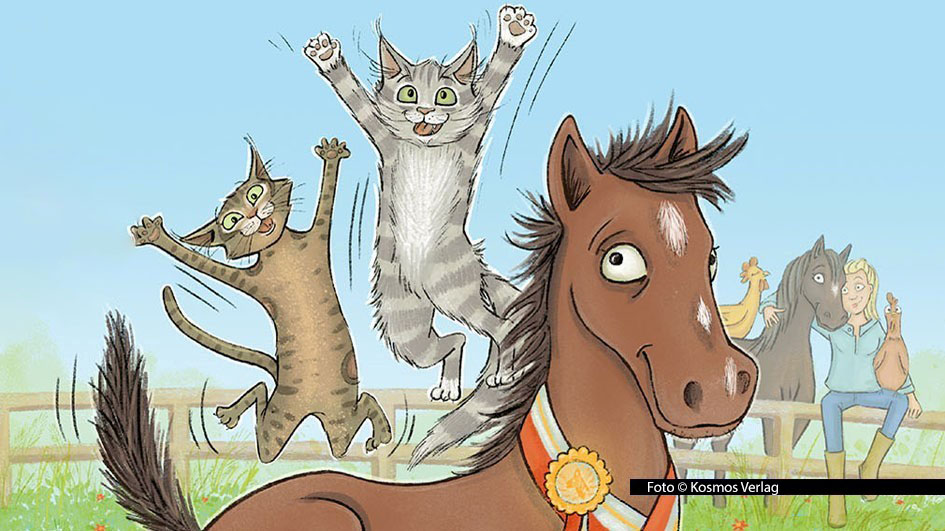Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde des RBB zurückgewiesen. "Die überwiegend zulässig angegriffenen Regelungen verletzen die Rundfunkfreiheit des RBB nicht", erklärte das Bundesverfassungsgericht. "Mit ihnen verfehlen die Landesgesetzgeber nicht die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks."
Streitpunkt war der Anfang 2024 inkraftgetretene Rundfunkstaatsvertrag, mit dem die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg nach dem Skandal um die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger für eine stärkere Kontrolle sorgen will. Der Sender sah die Rundfunkfreiheit etwa durch eine neue Regelung eingeschränkt, wonach der RBB "60 Minuten des täglichen Gesamtprogramms zur gesonderten Darstellung jedes Landes" senden soll, wie es im neuen Staatsvertrag heißt - doppelt so viel wie bisher.
Nach Auffassung des Verfassungsgerichts sei die konkrete staatsvertragliche Mindestzeitvorgabe jedoch "mit der Programmfreiheit als Kern der Rundfunkfreiheit vereinbar". Demnach bleibe die "publizistische Inhaltsfreiheit" erhalten. So lasse die zeitliche Mindestvorgabe dem Sender "weiten Raum zur weitergehenden zeitlichen Gestaltung", erklärten die Richter. "Die staatliche Einflussnahme erschöpft sich in einer Mindestwahrnehmbarkeit des regionalen Bezugs, der eine Grundlage und damit ein legitimes gesetzgeberisches Anliegen im Rahmen der gebildeten föderal-kooperativen Verantwortungsgemeinschaft ist."
Gestört hatte sich der RBB auch an der Bestimmung, wo konkret Regionalbüros und -studios in welcher Anzahl einzurichten seien. Doch auch hierin sehen die Richter keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Vielmehr diene die Festlegung einer "Flächenpräsenz des RBB". Sie diene der regionalen Vielfalt im Programm und werde dem Wesen des RBB als Mehrländerrundfunkanstalt gerecht.
Kritisch sah der RBB darüber hinaus einen nach seiner Auffassung gestärkten Einfluss der Politik auf das Personal des Senders, weil der Rundfunkrat alle fünf Jahre je eine Person wählt, die das jeweilige Landesprogramm von Berlin und Brandenburg leitet. Das Verfassungsgericht sieht auch das anders: Die vom RBB gerügte Schwächung einer allein handelnden Intendanz durch Verminderung ihrer Kompetenzen führe "nicht notwendig zu einer Einschränkung der Funktionsfähigkeit, sondern zunächst nur zu einer anderen Entscheidungsstruktur". Eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des Senders vermag das Gericht nicht zu erkennen.
"Diese Klarheit war für uns wichtig"
 © RBB/Thomas Ernst
Ulrike Demmer
© RBB/Thomas Ernst
Ulrike Demmer
Joachim Wieland, Prozessbevollmächtigter des RBB beim Verfahren in Karlsruhe, erklärte: "Der Beschluss betont die Bedeutung von Staatsferne und Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Hier noch einmal eine konkrete Präzisierung durch das Bundesverfassungsgericht zu erhalten, war ein zentraler Beweggrund für die Beschwerde des RBB."
Der RBB betonte zugleich, "so gut wie alle" im Staatsvertrag festgehaltenen Anforderungen umgesetzt zu haben. Im nächsten und letzten Schritt stehe nun an, die sogenannten "Leitungen der Landesangebote" einzusetzen. Dies werde sinnvoll geschehen können, wenn die zuletzt ausgeschriebene Position der Leitung der Programmdirektion neu besetzt sei.



 von
von