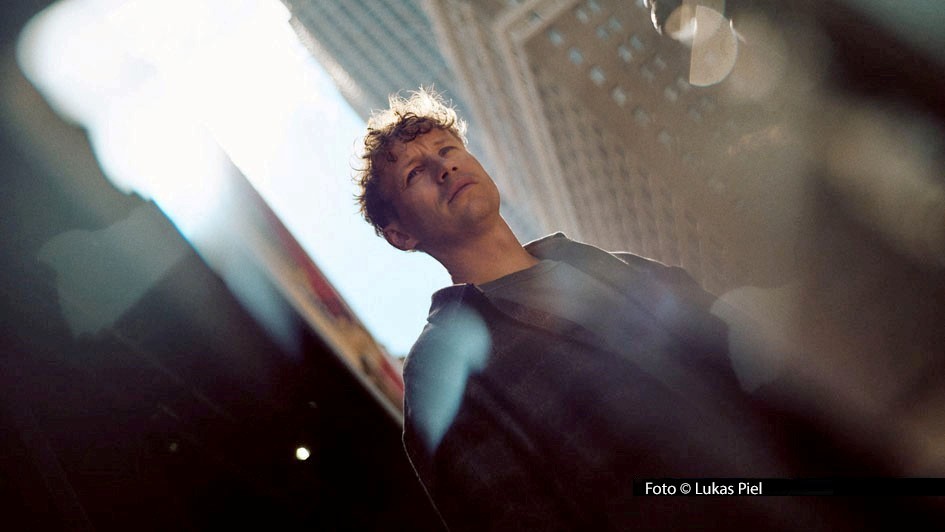Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass der Rundfunkbeitrag nur dann mit dem Grundgesetz vereinbar bleibt, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen verfassungsrechtlichen Funktionsauftrag erfüllt. Kommt es über längere Zeit zu "gröblichen" Verfehlungen bei der Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit der Programme, könnte die Beitragspflicht ihre verfassungsrechtliche Grundlage verlieren. Die Hürden dafür sind aber ziemlich hoch, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung hervorgeht.
Geklagt hatte eine Frau, die für den Zeitraum von Oktober 2021 bis März 2022 keinen Rundfunkbeitrag zahlen wollte. Sie argumentierte, ARD, ZDF und Deutschlandradio böten kein vielfältiges und unabhängiges Programm mehr, sondern dienten als "Erfüllungsgehilfen staatlicher Meinungsmacht". Daher habe sie keinen individuellen Vorteil durch das Angebot – und müsse folglich nicht zahlen. Es ist das erste Mal, dass sich das Bundesverwaltungsgericht mit einem solchen Fall befasste.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die Klage zuvor abgewiesen. Er sah den rechtfertigenden Vorteil allein in der Möglichkeit, das öffentlich-rechtliche Angebot grundsätzlich nutzen zu können – unabhängig von dessen Qualität oder inhaltlicher Ausgewogenheit. Das Bundesverwaltungsgericht hob dieses Urteil nun auf und verwies den Fall zurück nach München.
Die Leipziger Richter stellten klar, dass die Beitragspflicht nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zwar keine direkte Abhängigkeit von der Programmqualität vorsieht. Verfassungsrechtlich aber beruhe die Pflicht zur Zahlung darauf, dass das öffentlich-rechtliche Programm den gesetzlichen Funktionsauftrag tatsächlich erfüllt – also Meinungsvielfalt sichert, Orientierung bietet und ein Gegengewicht zum privaten Rundfunk bildet.
Das Gericht bezog sich dabei ausdrücklich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018, die den Rundfunkbeitrag damals gebilligt hatte. Schon diese Entscheidung habe die Beitragspflicht mit der Annahme begründet, dass das öffentlich-rechtliche Angebot den Anforderungen an Vielfalt und Ausgewogenheit entspricht. Sollte das jedoch nicht mehr der Fall sein, könne auch die Beitragserhebung verfassungsrechtlich ins Wanken geraten.
Hohe Schwelle für Verfassungsverstoß
Allerdings setzte das Bundesverwaltungsgericht die Hürden für eine solche Annahme sehr hoch. Erst wenn das Gesamtprogramm von Hörfunk, Fernsehen und Online-Angeboten über einen längeren Zeitraum – mindestens zwei Jahre – "evidente und regelmäßige Defizite" bei der Meinungsvielfalt aufweise, könne von einem verfassungsrechtlichen Missverhältnis zwischen Beitrag und Gegenleistung gesprochen werden.
Einzelne Fehler, Schieflagen oder politische Schwerpunktsetzungen reichten nicht aus. "Programmliche Vielfalt und Ausgewogenheit" seien Zielwerte, betonten die Richter. Sie ließen sich nur annäherungsweise erreichen, zumal den Rundfunkanstalten eine durch die Verfassung geschützte Programmfreiheit zustehe. Diese berechtige und verpflichte sie zugleich, ihren Auftrag eigenverantwortlich umzusetzen.
Ob die Klägerin die hohen Anforderungen erfüllen kann, bezweifeln die Leipziger Richter allerdings. Um eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht zu erreichen, müsse sie substantiiert und möglichst mit wissenschaftlichen Gutachten belegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk über längere Zeit gravierende Defizite bei der Meinungsvielfalt aufweist. Nach dem bisherigen Vorbringen erscheine das "überaus zweifelhaft", heißt es in der Entscheidung. Da das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsinstanz keine Beweise erheben darf, muss nun der Bayerische Verwaltungsgerichtshof prüfen, ob es überhaupt Anhaltspunkte für solche Mängel gibt.
Für die Klägerin bedeutet die Entscheidung, dass ihr Versuch, den Rundfunkbeitrag aufgrund angeblicher Einseitigkeit der Programme zu verweigern, vorerst gescheitert ist. Das Bundesverwaltungsgericht stellte klar, dass sie kein subjektiv-öffentliches Recht auf die Erfüllung des Rundfunkauftrags geltend machen kann. Weder die Informationsfreiheit noch die Rundfunkfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes begründen demnach ein individuelles Recht, den Beitrag zu verweigern. Ihr Erfolg hängt letztlich davon ab, ob sie über einen längeren Zeitraum eindeutige und regelmäßige Mängel in der Programmvielfalt nachweisen kann.
Signalwirkung über den Einzelfall hinaus
Die Entscheidung hat jedoch Bedeutung weit über den konkreten Fall hinaus. Sie bekräftigt einerseits die grundsätzliche Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags und damit die stabile Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Systems. Zugleich macht sie aber deutlich, dass die Beitragspflicht keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Auftrag zur Sicherung von Meinungsvielfalt und Staatsferne dauerhaft verfehlten, könnte dies die verfassungsrechtliche Grundlage der Beitragserhebung ins Wanken bringen.
Damit formuliert das Bundesverwaltungsgericht eine Art verfassungsrechtliche Leitplanke: Der Rundfunkbeitrag bleibt nur dann gerechtfertigt, wenn das öffentlich-rechtliche Programm seinem gesellschaftlichen Auftrag gerecht wird – als vielfältige und ausgewogene Stimme im deutschen Mediensystem.



 von
von