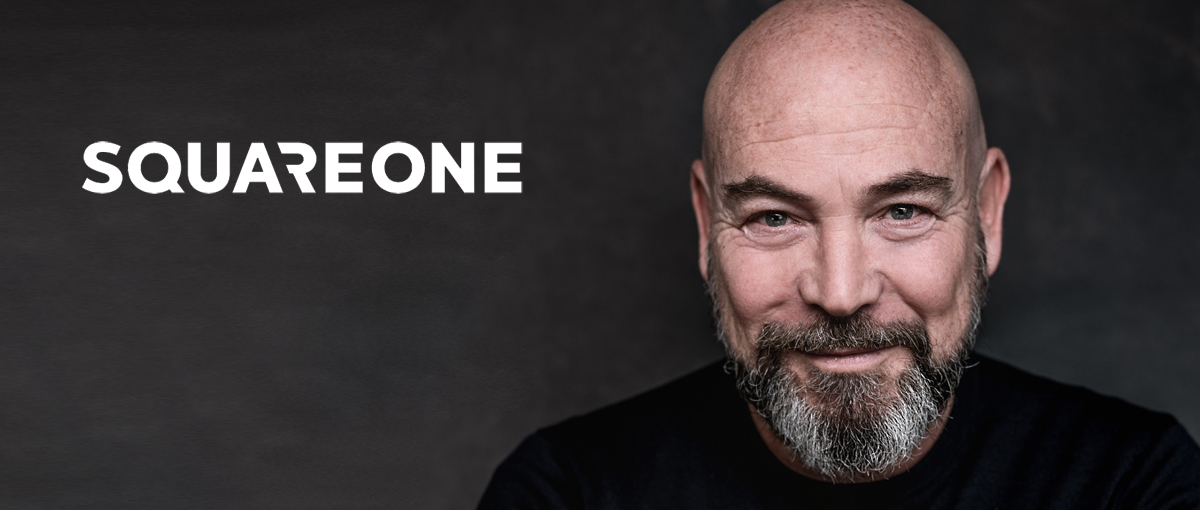Bei unserem letzten Gespräch vor zwei Jahren, ist von Ihnen der Satz gefallen, das Fernsehen sei von einer Goldgräber-Industrie zu einer Tellerwäscher-Branche geworden. Gilt das weiterhin?
Den Sendern muss wieder klar werden, dass bestimmte Leistungen einen Preis haben. Die Preise aus der Krisen-Zeit dürfen sich nicht dauerhaft konstant auf diesem Niveau bewegen. Wir sind den Sendern damals entgegenkommen und andere Produzenten ihren Sendern auch. Es ist nicht nur ein Sender, der sich stabilisiert hat, weil die Produzenten dramatische Einschränkungen hingenommen haben. Aber irgendwann ist Zahltag. Die Sender stehen in einer Bringschuld und müssen diese Leistungen entweder über Längerfristigkeit von Verträgen oder schlicht über den Preis honorieren. Die Produzenten haben ihre Hilfe erbracht. Den Gedanken kann und wird die Produzenten-Allianz ganz bestimmt auch im nonfiktionalen Bereich weiter vorantreiben.
Im Falle von „The Winner is...“ hatte sich Sat.1 in John de Mol verliebt...
Sich in John de Mol zu verlieben, ist nicht so schwer. Das hat RTL schon vor 25 Jahren intensiv gemacht. Er hat in der Tat eine Aura um sich, die allen anderen vermittelt: Vertraut mir, und alles wird gut. Als oft geprügelter Senderredakteur ist man schon bereit, sich auf dieses Charisma einzulassen. Die entscheidende Frage lautet aber: Hast du die Rückendeckung im Haus, um gewisse Formate so lange durchzuziehen, bis eine gewisse Zahl an Zuschauern den Weg dorthin gefunden hat? Deshalb kann ich nur aufrufen: Habt Mut, Mut, Mut!
Nach diesem Credo könnte Harald Schmidt noch laufen. Die Marken von Sat.1 werden damit immer weniger...
Als ich damals zu Sat.1 gewechselt habe, waren die bei RTL die armen Kirchenmäuse und Sat.1 schien mir so gut wie alles zu haben – sogar bereits eine Corporate Identity, über die man sich bei RTL damals noch keine Gedanken gemacht hatte. Sat.1 war fiktional gebrandet, hatte alle Filme und Serien, nicht zuletzt wegen Leo Kirch. Bei RTL war es vollständig anders: Dort hat man sich die Inhalte selbst ausdenken müssen, weil kaum Geld bereit stand, etwas ankaufen zu können. Dadurch hat man eine Kultur für die Entwicklung von Eigenformaten begründet, die ich bis zum heutigen Tag durchgehalten sehe: Durch vor allem journalistische Unterhaltung hat man den Zuschauer gefesselt und ihm signalisiert, bei ihm zu sein. Ein kultureller Scheideweg zwischen RTL und Sat.1, der vor über 20 Jahren begann und der ein Zusammenführen beider Routen nicht mehr möglich macht.
Man kann die Unterschiede also nicht mehr zurückdrehen?
Nein, man kann das dem Sender auch nicht vorwerfen. Die Arbeit von Journalisten bei Sat.1 war häufig die von sehr konservativen Kollegen, auch um den Auftritt des Hauses vor dem Hintergrund der Überlegungen der Eigentümer deutlich zu machen: „Wir sind katholisch und konservativ – und das soll auch jeder mitbekommen.“ Das war selbstverständlich nicht immer massenkompatibel. Wir müssen also heute stets aufpassen, wo wir herkommen.
Weil Sie eben von Nähe zum Zuschauer und Corporate Identity gesprochen haben: RTL sagt mir „Mein RTL“, Sat.1 wirbt mit „Colour Your Life“...
Bei „Mein RTL“ klingt das „mein“ fast zärtlich und ist damit viel mehr als besitzanzeigendes Fürwort. Ich finde es ganz bemerkenswert, wie man mit zwei Wortbegriffen diesen Effekt erzeugen kann. Letztlich habe ich aber schon das Gefühl, dass Sat.1 – also der Sender, dem ich 20 Jahre mein Gesicht und einen großen Teil meines Arbeitslebens gewidmet habe – ein wenig unter Wert geschlagen wird.
Sie machen einen recht entspannten Eindruck. Sie waren lange Zeit für alles verantwortlich – also sowohl für die Sendung, als auch für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Hängt Ihre Entspannung auch damit zusammen, dass Sie letztere Last inzwischen an Endemol bzw. den Kollegen Ollie Weiberg abgegeben haben?
Was da von meinen Schultern genommen wurde, lässt sich wahrscheinlich in Zentnern gar nicht ermessen. Ich erlebe ein gewaltiges Mehr an Lebensqualität, wie ich es mir nicht hatte vorstellen können. Aber es geht mir nach wie vor um die dauerhafte Sicherung von Arbeitsplätzen in der Produktionsfirma. Dafür tue ich nicht nur eine Menge, sondern so gut wie alles.
Sie haben Ihre Firma von Anfang an mit aufgebaut. Allerdings gab es jahrelang den Trend, dass jeder, der drei Sätze in die Kamera gesagt hat, spätestens ab der zweiten Staffel selbst produzieren wollte. Daraufhin sind Firmen entstanden, von denen es viele inzwischen gar nicht mehr gibt. Wie beobachten Sie das?
Viele haben versucht, diesen Weg zu gehen, aber es haben nur sehr wenige erfolgreich durchgehalten. Man muss sich nämlich bewusst werden, dass der Auftritt vor der Kamera der winzigste Teil des Jobs ist. Viel wichtiger ist der Einfluss in die Redaktion hinein – und zwar dauerhaft. Außerdem muss man sich überall einbringen und zwar auch dort, wo es richtig weh tut und viel Arbeitszeit kostet. Ich sehe mich als Ärmel-Hochkrempler und bin mir für keine Aufgabe zu schade, wenn es für uns darum geht, das, was man auf die Antenne schickt, noch einmal besser zu machen. Eine Frage des Charakters.