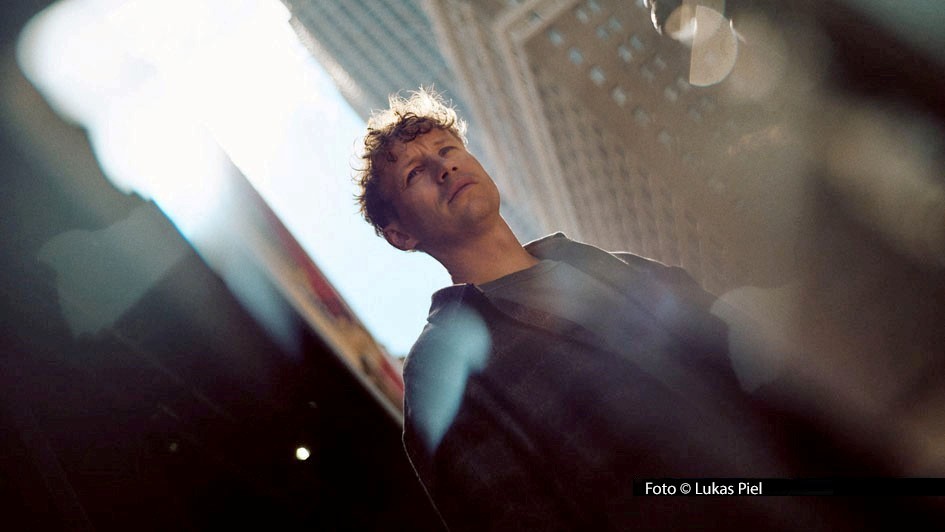Frau Wildermuth, was macht Ihnen gerade mehr Sorgen: Die deutsche Medienpolitik, Künstliche Intelligenz oder der NDR beim Thema „Klar“?
(lacht) Ich bin grundsätzlich ein zuversichtlicher Mensch, aber es gibt Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Und da ist sicher der Wandel der Medienwelt die substanziellste, weil es dabei um die Hoheit über unsere Informationsräume und die Sicherung von öffentlichem Diskurs in unserer Gesellschaft geht.
Das zielt in Richtung KI?
Ja, aber es geht mir nicht um KI als Werkzeug im kreativen Prozess, das nutzen wir sehr kollaborativ, haben dafür als BR um Uli Köppen eine KI-Abteilung eingerichtet, um die uns viele in Europa beneiden. Und ein großartiges Netzwerk gegründet, „AI for Media“, mit inzwischen tausend Mitgliedern und allen führenden deutschsprachigen Medienhäusern, die sich austauschen zu KI-Werkzeugen für Kreation, Redaktion und Produktion. Ein kooperativer Geist, statt zu versuchen, einzeln das Rad neu zu erfinden.
Wo sehen Sie die substanziellere Herausforderung?
Bei der Frage, wie Künstliche Intelligenz die Wege ändert, auf denen Nutzerinnnen und Nutzer zu Informationen kommen: Wie verändert das unsere gesamte Medienwelt, im Grunde alles, was wir wahrnehmen? Wie verändert sich der öffentliche Raum? Wir merken einerseits, dass es eine immer größere Herausforderung wird, mit unseren linearen Programmen sichtbar zu sein, selbst auf Geräten, auf denen wir mal sehr prominent waren, dem Fernseher oder Autoradio. Diese Geräte bieten im Wohnzimmer und unterwegs längst mehr als das Programm einiger Sender. Und ganz besonders herausfordernd wird es bei KI-gesteuerten Informationsräumen, wenn KI-Chatbots genutzt werden oder Google seinen AI Overview dazwischenschaltet. So bekommen einige wenige internationale Player die Hoheit über unsere Informationsräume. Damit schöpfen sie nicht nur Geld aus dem Markt ab, es geht inzwischen auch um Macht und Politik.
Und wie reagiert man darauf? Anpassung, Dialog, Regulierung?
KI verändert alles, aber nicht unseren Auftrag, vertrauenswürdige Informationen und eine emotionale Nähe zu unserem Publikum herzustellen. Und das gelingt dem Bayerischen Rundfunk sehr gut. Wir sind, das zeigen Umfragen, eine Trusted Source. Vertrauenswürdige Informationen sind die Basis für demokratische Meinungsbildung, aber nur, wenn damit integer umgegangen wird. Was dem entgegenwirkt, ist, wenn etwas aus dem Zusammenhang gerissen wird. Wenn die Absenderschaft nicht mehr erkennbar ist. Es muss sichergestellt sein, das deutlich erkennbar und mit Kontext zitiert wird.
Wie kann das gelingen?
Das hat nicht nur etwas mit Urheberrecht zu tun, sondern bereits mit Absenderkennung und mit dem Schutz unserer Informationen, die ja mit großer handwerklicher Qualität und nach journalistischen Kriterien zusammengestellt werden und die eben, wenn man sie zerfleddert, nicht mehr diese Qualität binden. Natürlich reden wir hier von Regulierung, das ist völlig klar. Der Global Risks Report hat nun im zweiten Jahr Desinformation als eine der größten Herausforderungen der Menschheit benannt. Ich würde das unterstreichen und mir wünschen, die Politik würde mit gleicher Leidenschaft und Handlungsbereitschaft auf Desinformation schauen, wie sie aktuell auf Drohnen schaut. Das ist für mich eine Frage der nationalen Sicherheit.
Das klingt dann doch schon nach Sorge, fast schon eindringlicher Warnung ...
Am Ende des Tages, da müssen wir uns nichts vormachen, ist das auch eine Gefahr. Demokratie und demokratischer Diskurs funktioniert nur auf einer gesicherten Faktenbasis. Und wenn wir sehen, dass Desinformation aus unterschiedlichen Richtungen kommt, aber genau damit arbeitet, dass das Vertrauen in Fakten destabilisiert werden soll, dann müssen wir das sehr, sehr ernst nehmen. Denn es ist eine andere Form von Destabilisierung unserer bisherigen demokratischen Verfasstheit.
Neben der Hoffnung auf die Politik: Kann mehr Fokus auf Medienkompetenz helfen?
Wir haben uns als Bayerischer Rundfunk in unserem Unternehmenskompass zum Ziel gesetzt, jeden zweiten Schüler in Bayern während seiner Schullaufbahn einmal mit einem unserer Medienkompetenzprojekte zu erreichen. Das ist sehr aufwendig, aber umgekehrt auch sehr wichtig. Trotzdem brauchen wir meiner Meinung nach eine deutlich höhere Sensibilisierung für das Risiko. Die Macht im Informationsraum liegt teilweise bei Playern, die Fact Checking als Zensur betrachten. Wir haben ja alle den US-Vizepräsidenten JD Vance bei der Sicherheitskonferenz gehört. Es ist dringend geboten, sich damit zu beschäftigen. Wir brauchen klarsichtige Medienpolitik mit Engagement für unsere Werte.
Sie kritisieren Meta scharf, nutzen es als BR aber trotzdem. Wie geht das zusammen?
Eine berechtigte Frage, die wir uns immer wieder neu stellen bei jeder Entwicklung. Gerade zum Beispiel die Google AI Overviews. Gerade wenige Monate alt, haben sie aber schon gravierende Folgen für den gesamten Medienmarkt. Und wenn kommerziellen Anbietern das Geschäftsmodell wegbricht, beunruhigt mich das als Bürgerin wie Intendantin auch, denn wir sind so eine starke Demokratie dank der medialen Vielfalt. Weil eine starke Demokratie mediale Vielfalt braucht.
Richtig, das war aber jetzt eigentlich nicht die Frage…
Ein wesentlicher Teil unseres Auftrags ist, zur demokratischen Meinungsbildung beizutragen und dafür müssen wir auch dort sein, wo sie stattfindet. Wenn wir sehen, wie viele gerade auch junge Menschen inzwischen ihre politische Information über TikTok beziehen, dann bin ich froh, dass die „Tagesschau“ dort die erfolgreichste deutsche Nachrichtenmarke ist und auch BR24 dort stattfindet und viel Zuspruch findet. Bezüglich der nötigen Regulierung sehe ich gute Ansätze in Brüssel. Aber wir müssen gleichzeitig selbst auch aktiver werden.
"Unsere Antwort können eigene KI-Agenten sein (...) Wir haben einen so großen Schatz an verlässlichen Quellen in der deutschen Medienlandschaft."
Was meinen Sie?
Wir müssen auffindbarer Anlaufpunkt für verlässliche Information bleiben. Wenn das bedeutet, dass wir eigene KI-Agenten erstellen, dann machen wir das. Denn im Moment sehen wir die Fehleranfälligkeit bei manchen Chatbots, weil die Datenbasis oft kein Mindestmaß an Qualität gewährleistet. Unsere Antwort darauf können eigene KI-Agenten sein. Wir haben zum Oktoberfest zusammen mit Ippen Media den Breznbot entwickelt und getestet. Ein erster Versuch, Erfahrungen zu sammeln. Geht das? Ist das Raketenwissenschaft? Schaffen wir das? Und die Antwort ist: Wir können das schaffen. Wir sollten uns trauen. In Zusammenarbeit mit privaten Medienhäusern können wir Quellen und Qualitätsjournalismus bündeln. Wir haben einen so großen Schatz an verlässlichen Quellen in der deutschen Medienlandschaft. Ich finde, wir müssen nicht so verzagt sein zu sagen, da ist der Zug schon wieder abgefahren. Das ist er nicht. Aber wir müssen schnell sein, mutig und selbstbewusst.
Herausforderungen durch KI von außen, gleichzeitig fehlende Rückendeckung der Medienpolitik im Inland und ein Bundesverfassungsgericht, das sein Urteil verschiebt?
Ich bin nicht nur berufsoptimistisch, dass sich geltendes Recht am Ende durchsetzen wird. Und ich habe den Eindruck, dass angesichts der Erosion von Recht und Werten, von Gewaltenteilung und Institutionen auf anderen Kontinenten bei uns ein neues Bewusstsein dafür entstanden ist, dass unsere demokratische Verfasstheit und dazu gehört unstrittig der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein großer Wert ist. Wir sollten vor lauter Klein-Klein nicht das große Ganze aus den Augen verlieren. Von daher nehme ich auch in der Medienpolitik wieder mehr Rückhalt wahr.
Die Verfassungsklage von ARD & ZDF war eine Formsache, wurde aber in der Medienpolitik als Affront aufgefasst. Wie argumentiert man gegen Emotionen und Stimmungen?
Die Kernidee der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs liegt darin, dass die Ermittlung der Beitragshöhe unabhängig von politischen Strömungen erfolgt. Es ist ja eben keine Steuer, die mit jeder neuen Regierung zur Disposition gestellt werden kann. Es ist ein politikfernes, stimmungsfernes, komplexes und sehr mathematisch ablaufendes Verfahren. Das erweist sich in Zeiten, wo Politik wie manche gesellschaftliche Debatte sehr emotional und wellenartig agiert, als wichtiger Anker und Sicherheit von Rundfunkfreiheit. Sie nennen es Formsache, ich sage: Die Klage gilt der Feststellung des geltenden Rechts.
Weil Sie das politikferne Verfahren gerade so betonen, stellt sich mir aber eine Frage: Sollte die AfD im kommenden Jahr bei den Landtagswahlen in eine Landesregierung kommen und den Medienstaatsvertrag kündigen - hat sich überhaupt schon mal jemand damit beschäftigt, was das dann bedeuten würde?
Die Situation würde jedenfalls sehr komplex, weil es verfassungsrechtliche Absicherungen gibt – es kann nicht einfach keine Öffentlich-Rechtlichen geben – weil es weiterhin andere geltende Landesgesetze gibt und auch weil der Medienstaatsvertrag wichtige Regeln für den privaten Rundfunk enthält. Wenn Sie mich fragen, ob mich die Fragestellung beunruhigt: Nein. Mich beschäftigt viel naheliegender, wie salonfähig populistische Narrative schon geworden sind. Das ist der Kontext für diese Debatte: Wir erleben nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, dass populistische Kräfte versuchen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter zu diskreditieren.
Und warum, Ihrer Meinung nach?
Weil Populismus davon lebt, dass die Fähigkeit der Menschen, zwischen Wahrheit und Nicht-Wahrheit zu unterscheiden, schwindet. Weil Populismus davon lebt, dass Fact Checking auch nur als Meinung abgetan wird. Und weil Populisten die Klaviatur der zuspitzenden Emotionalisierung besser und unverantwortlicher spielen können als diejenigen, die in Verantwortung stehen. Das ist sozusagen der größere Kontext, den wir immer betrachten müssen.
Ist dann ein Format wie „Klar“ der Versuch, Menschen, die sich mit ihren Themen und Sorgen sonst nicht abgeholt fühlen, noch innerhalb des öffentlich-rechtlichen Journalismus zu halten?
Wir haben mit „Klar“ ein neues Format ausprobiert. Wir haben uns auch entschieden, es weiterzumachen, und es ist redaktioneller Alltag für uns, Formate selbstverständlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Mit Blick auf die entstandene Debatte würde ich uns allen raten, die eigene Erregungsspirale zu hinterfragen. Denn egal ob Befürworter oder Kritiker des Formats: Wenn wir zuspitzen, polarisieren und emotional aufladen, hilft das nur allen, die den öffentlichen Diskurs destabilisieren wollen.
Nun ja. Julia Ruhs hat vom Start weg polarisiert und emotional aufgeladen. Schon mit ihrem Einstieg…
Ein Großteil der Debatte fokussierte sich sehr stark auf die ersten Minuten der allerersten Folge. Ich habe sehr meinungsstarke Einschätzungen von vielen bekommen, die noch nicht mal alle drei Teile dieses ja nur dreimal 45 Minuten langen Formats gesehen haben. Nicht nur thematisch, sondern auch in der Tonalität unterscheidet sich die dritte Folge von der zweiten, die wiederum auch schon von der ersten. Und jetzt werden erfahrene Redakteure dieses Format gut weiterentwickeln und nach der ersten Saison können wir gerne eine grundsätzliche Debatte darüber führen, wie das Format sich positioniert und wie es aufgesetzt ist. Der Blick auf die ersten paar Minuten der allerersten Folgen scheint mir die Debatte zu verengen.
Mit Verlaub: Es sind nun nicht nur die ersten Minuten. Frau Ruhs kultiviert ihre Selbstdarstellung als so etwas wie die einzige unabhängige Journalistin der ARD auch auf ihren Social-Kanälen. Ein nicht ganz neues Grundsatz-Thema, wie privat Social Media eigentlich ist…
Die Social Media Guidelines des BR gelten für alle gleichermaßen und selbstverständlich. Sie zielen auch darauf ab, dass man sich bewusst macht, dass man mit dem Heimatsender assoziiert wird und dass man damit verantwortungsvoll umgeht.
Angesichts oft auftretender Eskalation die allgemeine Frage: Müssen wir wieder mehr Diskurs im öffentlichen Miteinander lernen?
Ich würde gar nicht sagen, dass wir das verlernt haben. Aber die Zeiten verändern sich. Wir diskutieren im Moment im politischen Raum über Themen, das hätten wir uns vor ein paar Jahren nicht träumen lassen. Dann treffen Erregungsspiralen auf den Zerfall von Informationsräumen. Und dann müssen wir intern reflektieren: Was bedeutet das für uns als Bayerischer Rundfunk? Wie sieht unsere Rolle aus?
Wenn sich Themen verschieben, woran hält man dann fest. Was ist der Kompass?
Wir haben beim BR ein internes Format, in dem wir aus sehr unterschiedlichen Perspektiven – vom Regionalreporter über den analytischen Journalisten in der Redaktion, vom Techniker bis zum Kantinen-Mitarbeiter – diskutieren und zu ermitteln versuchen: Was sind die Diskurse der Zeit? Gibt es irgendwo eine Perspektive, die wir stärker einbinden müssen oder eine, die wir überbetonen? Da gibt es meiner Meinung nach kein Patentrezept. Wovon ich aber fest überzeugt bin: Wir müssen in diesem ständigen Austausch bleiben. Das ist auch ein Muskel, den man trainieren kann. Und je mehr und je dynamischer sich die Welt ändert, desto wichtiger ist, dass wir als Journalisten immer wieder in den Prozess der Selbstvergewisserung gehen.
"Der öffentlich-rechtliche Auftrag ist genau das Gegenteil von einer Bubble"
Aber es gibt Bevölkerungsschichten, die offenbar nicht mehr erreichbar sind für Journalismus, weil sie sich aus einer eigenen Bubble bestärken…
Und der öffentlich-rechtliche Auftrag ist genau das Gegenteil von einer Bubble. Aber Sie haben Recht, wir beobachten eine wachsende Erwartung der Selbstbestätigung, so wie sie von Algorithmen und gefälligen WhatsApp-Gruppen geliefert wird. Und auch wenn diese Erwartung auf Qualitätsjournalismus trifft und die eigene Perspektive nicht 1:1 vorkommt, werden wir weiter beim Qualitätsjournalismus bleiben. Der entfaltet übrigens auch seinen Zauber im Radio. Wo auf Musik ein Hörfunk-Feature folgt zu einem Thema, das der persönliche Algorithmus vielleicht nie ausgespielt hätte.
Wie steht es eigentlich um den Umzug des Bayerischen Rundfunks nach Freimann? Ist der Umzug und damit auch Umbau abgeschlossen?
Wir sind, wenn Sie so wollen, auf der Zielgeraden. Mit Bayern 3 ist die erste Radioredaktion erfolgreich vom Münchner Hauptbahnhof nach Freimann umgezogen, Bayern 2 folgt im Dezember. Neu und besonders ist, dass wir unsere Standorte nicht mehr nach Ausspielwegen strukturieren, sondern die Mitarbeitenden zusammenbringen, die an den gleichen Themen oder in den gleichen Themenfeldern arbeiten, egal ob für Audio oder Video. Das wird von vielen als Befruchtung wahrgenommen, der Campus-Gedanke geht sehr gut auf.
In dem Zuge endet das lineare Programm von Puls, der jungen BR-Marke, allerdings eher als geplant.
Die Marke Puls behalten wir natürlich weiterhin. Sie steht für junge Formate, etwa „Puls Startrampe“ für Nachwuchsförderung von Bands aus Bayern. Puls wird weiterhin auch unabhängig von einem linearen Radio-Programm für Formate stehen, die den urbanen aber auch ländlichen Charakter unseres Sendegebiets abbilden. Für uns stand schlicht die Frage im Raum: Bauen wir jetzt beim Umzug noch ein Hörfunkstudio oder stecken das Geld lieber in Inhalte? Und wir haben mit Blick auf das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen entschieden: Der Rundfunkbeitrag ist in neuen Formaten und Ideen besser aufgehoben als in neuen Studiowänden.
Sie sind innerhalb der ARD auch die für die EBU-Themen zuständig. Das dürfte im Dezember noch spannend werden…
Der Eurovision Song Contest ist über viele Jahrzehnte, die auch alles andere als unpolitisch waren, so erfolgreich geblieben, weil er immer dem Motto „United by Music“ gefolgt ist. Der Contest ist ein Wettbewerb zwischen Künstlern und Sendern und nicht zwischen Staaten. United by Music bedeutet Vielfalt, bedeutet Respekt und Brücken zu bauen. Es gibt Regularien des ESC, die genau das sicherstellen. Die sicherstellen, dass aktuelle politische Strömungen und Debatten diese Werte des Brückenbauens, der Vielfalt und des Respektes nicht beeinträchtigen. Gerade in Zeiten, in denen andernorts der Respekt vor Regularien und auch vor Werten abnimmt, müssen wir darauf dringen, dass es genau das ist, was die Stärke dieses Wettbewerbs ausmacht.
Das bedeutet?
Wir werden uns selbstverständlich dafür einsetzen, dass der unabhängige öffentlich-rechtliche Sender KAN Teil des Wettbewerbs bleibt. Darum wird es Anfang Dezember auf der General Assembly der EBU gehen. Unsere Position ist da sehr klar.
Letzte Frage: Woran würden Sie sich am Ende Ihrer Amtszeit gerne messen lassen?
Mit unserem BR Unternehmenskompass haben wir uns klare Ziele gesteckt. Wir wollen weiterhin zwei von drei Menschen in Bayern erreichen. Wir wollen weiterhin verantwortungsbewusst unsere finanziellen Mittel einsetzen und einer der Top 10-Arbeitgeber in Bayern bleiben. Das wichtigste Ziel ist, dass auch weiterhin drei von vier Menschen in Bayern sagen: „Es ist gut, dass es den BR gibt und dafür bezahle ich gerne meinen Beitrag.“ Der BR steht für Verlässlichkeit und die Nähe zu seinen Publika, darum beneidet uns ganz Europa, da ist die föderale ARD so stark ist wie niemand anders. Dafür stehen 30 Korrespondentenbüros allein in Bayern und auch ganz viele Formate, wie es sie nirgendwo sonst gibt. Wir sind der Anker für Verlässlichkeit und für emotionale Nähe. Meine Aufgabe ist es, in diesen wirklich disruptiven und herausfordernden Zeiten diese Stärken in eine neue Zeit zu führen. Deswegen experimentieren wir weiter mit großer Leidenschaft zum Beispiel mit neuen Formen von Digitalprodukten wie KI-Agenten. Und auf der anderen Seite konzentrieren wir uns noch mehr auf unsere Stärken, auf das, was uns unverwechselbar macht.
Frau Wildermuth, herzlichen Dank für das Gespräch.



 von
von