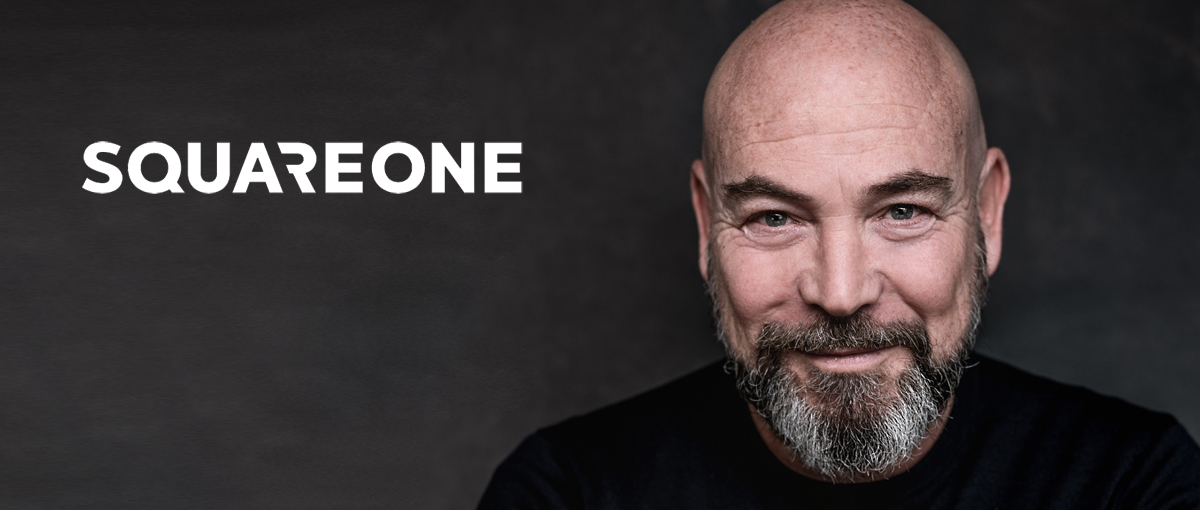Gibt es Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Produktionen? Woran lässt sich das festmachen?
Das ist eine Frage der Tonalität. Die Adressierung eines Themas ist im US-Fernsehen deutlich lauter und eindeutiger als sie es bei der vergleichbaren Dokumentation in Deutschland wäre. In den USA sehen und hören sie häufiger Superlativen. Bei uns ist man im Ton vielleicht ein bisschen subtiler. Das beschreibt im Grunde den Unterschied zwischen europäischen und amerikanischen Produktionen, gar nicht so sehr einen deutsch-amerikanischen Unterschied. Das US-Angebot im Bereich Dokumentation fühlt sich für mich auch deutlich männlicher an, was daran liegt, dass Doku-Sender wie Discovery und National Geographic sich primär an männliche Zuschauer richten während wir in Deutschland Dokumentationen in erster Linie im Rahmen von Vollprogrammen platzieren, die eine ausgewogenere, wenn nicht sogar eher weibliche Zuschauerschaft haben.
Im deutschen PayTV gibt es aber inzwischen ja auch z.B. die von Ihnen genannten US-Marken sowie deutsche Doku-Sender. Sind die eigentlich relevante Auftraggeber für Sie? Oder doch nur Abspielstationen?
Die Investments werden langsam größer. Die Digitalsender, egal ob pay oder free, geben langsam mehr Geld aus. Ich gehe davon aus, dass dieser weiter Markt wächst - und das wird für uns sehr interessant. Aber es gibt noch einen Markt zwischen Deutschland und den USA: Den internationalen Markt. Denn nicht nur Discovery in Deutschland und den USA suchen Programme, auch das internationale Netzwerk von Discovery mit Sendern rund um den Globus sucht Programme. Und das soll gar nicht so amerikanisch aussehen, damit es international gut einsetzbar ist. Hier können wir auch unsere Stärke ausspielen, weil wir auch international, nicht nur US-amerikanisch orientiert sind.
Wie groß ist der Anteil dieser internationalen Produktionen an ihrem Geschäft?
Unsere Aufträge kommen zu 80 Prozent von deutschen Sendern. Die Kollegen in Washington konzentrieren sich auf den nordamerikanischen Markt. Die restlichen 20 Prozent sind Koproduktionen bei denen wir zusammenarbeiten und ggf. auch Partner an Bord holen.
Beim Realscreen Summit in Washington wurde wieder mal deutlich, wie sehr in den USA alles im Bereich Factual über bzw. um starke Charaktere erzählt wird. Wie sieht das bei uns aus? Wonach gucken die Sender?
Ich glaube, dass das einer der großen Trends in den vergangenen Jahren war. Auch das deutsche Fernsehen war im Bereich Factual und Dokusoap sehr stark Charakter-getrieben – in verschiedenen Variationen. Also Charaktere, die als Kern ein ganzes Format tragen oder aber Hosts. Noch vor zehn Jahren wäre es doch undenkbar gewesen, dass Hape Kerkeling eine Reihe zur Weltgeschichte hostet. Ich finde das toll, weil Hosts die Zuschauer gut mit der sehr spezifischen Thematik der jeweiligen Sendung verbinden können. Aber ich stelle auch fest, dass es wieder eine Bewegung hin zu Themen-getriebenen Produktionen gibt. Der Zuschauer will wieder Substanz. Im vergangenen Jahr haben wir beispielsweise ein „Galileo Spezial“ zum Thema „Supermacht China“ umgesetzt - ohne Host. Also bewegten wir uns da im Grunde im Bereich der Auslandsreportage - und erreichten damit 15,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist für mich ein Beweis, dass anspruchsvolle journalistische Inhalte sowohl zur besten Sendezeit, als auch beim jungen Publikum funktionieren.
Da wird aber auch noch manchmal die Nase gerümpft, gerade von öffentlich-rechtlicher Seite. „Galileo Spezial“ sei doch etwas banal...
Oh, da sind wir bei meinem Lieblingsthema. Wir sind ein Produzent, der für beide Welten arbeitet - also öffentlich-rechtliche und private Sender. Unser Versuch ist der, aus beiden Welten das Beste zusammenzubringen. Ich bin überzeugt davon, dass das möglich ist - also den Bildungsanspruch der Öffentlich-Rechtlichen und den Unterhaltungsanspruch der Privaten - zu verbinden. Darin liegt überhaupt kein Widerspruch. Dieses Schwarz-Weiß-Denken haben die Sender längst abgelegt, auch wenn sie manchmal noch anders reden. Qualitätsfernsehen darf kein Nischenprogramm sein und es wäre grotesk, wenn wir uns damit zufrieden geben würden. Das merken auch zunehmend Fernsehmacher auf beiden Seiten, die doch längst auch die Kompetenz des Anderen für sich beanspruchen wollen.
Aber wer braucht was dringender? Die Öffentlich-Rechtlichen Unterhaltungskompetenz oder die Privaten den Bildungsanspruch?
(lacht) Fifty-Fifty. Da muss ich diplomatisch bleiben.
Sie haben ja vor Storyhouse sehr lange auf Senderseite gearbeitet. Hat sich Ihre Auffassung von der Rollenverteilung zwischen Sender und Produzent verändert?
Nein. Der Eine bringt hervorragendes Knowhow mit über Schedule, AudienceFlow, die Marke und Zielgruppe. Sehr viel Forschungswissen, das der Produzent in der Regel nicht hat. Und der Produzent ist eben derjenige, der macht. Der letztlich das Fernsehen produziert, die Kreativität beisteuert und im jeweiligen Thema drin ist. Wenn das zu einem kreativen Prozess zusammenkommt, dann ist es klasse. Das ist übrigens etwas, was den deutschen sehr vom amerikanischen Fernsehmarkt unterscheidet. Hier wird sehr eng miteinander entwickelt. In den USA gibt der Sender ein Briefing und der Produzent liefert dann irgendwann sein Konzept das entweder abgelehnt oder angenommen wird. Da wird nicht viel gemeinsam überlegt.



 von
von