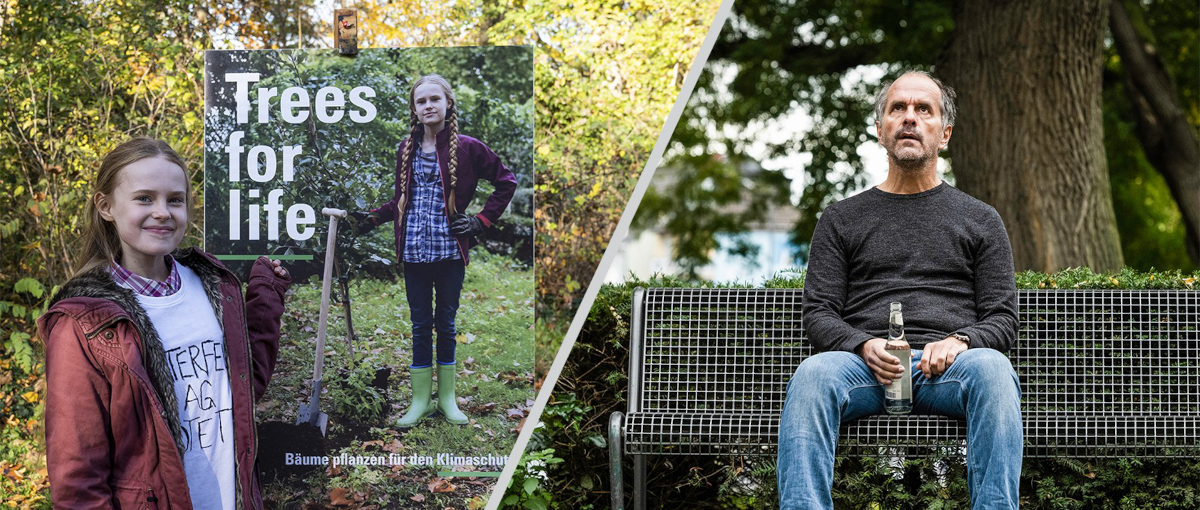Herr Koll, kann man die Welt in einer halben Stunde überhaupt ansatzweise adäquat abbilden?
Nein, deswegen muss man ja auch jede Woche das "Auslandsjournal" einschalten. (lacht) Die halbe Sendestunde kann natürlich immer nur einige wenige Themen beleuchten. Über die längere Strecke fügt sich aus den vielen Facetten und Korrespondentenberichten dann aber doch ein großes Ganzes. Zusätzlich haben wir die monothematischen Sendungen entwickelt, bei denen wir ein Land auch mal in der Tiefe darstellen können, so wie kürzlich bei Brasilien…
Für diese Sendung haben Sie auch den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Kommt diese Tiefe, die Sie ab und an in diesen XXL-Ausgaben ausspielen können, dem deutschen Fernsehen grundsätzlich zu kurz?
Nein, ich glaube nicht. Wir haben eine extrem gute und umfassende Auslandsberichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das gilt nicht nur für das "Auslandsjournal" - sondern auch für den "Weltspiegel". Und in anderen aktuellen Sendungen spielt die Auslandsberichterstattung ebenfalls eine ausgeprägte Rolle. Und zwar vollkommen zu Recht, denn die Welt und ihre Entwicklung betrifft uns immer unmittelbarer.
Gefühlt spielt die Auslandsberichterstattung in anderen Ländern wie Frankreich oder den USA keine so große Rolle. Ist es eher ein Phänomen des deutschen Fernsehens?
Die Franzosen interessieren sich stärker für ihre ehemaligen Kolonialgebiete, die USA für den eigenen nationalen Bauchnabel. Für uns Deutsche war und ist immer besonders wichtig, was andere über uns denken. Über Jahrzehnte haben wir uns, quasi als Beilage zum Sonntagsbraten, im "Internationalen Frühschoppen" von mehr oder weniger gut Deutsch sprechenden, ausländischen Korrespondenten erklären lassen, wie das Ausland die Deutschen sieht. Das wäre einem Briten nie eingefallen, hat aber natürlich viel mit unserer belasteten Vergangenheit zu tun. In Nationen, die eine ungebrochen positive, nationale Geschichte haben, ist das anders. Aber wissen Sie, was BBC World während meiner Korrespondentenzeit in England eingeführt hat?
Einen "Internationalen Frühschoppen"?
Genau. "Dateline" ist wie der gute, alte "Internationale Frühschoppen", allerdings alkoholfrei. Ich war dort regelmäßig sonntags eingeladen, um mit anderen ausländischen Korrespondenten über britische Politik und Befindlichkeit zu debattieren. Aber wir reden von der internationalen BBC-Ausgabe, in der nationalen ist das noch immer schwer vorstellbar.
Wenn man mit Auslandskorrespondenten spricht, keimt immer mal wieder die Kritik auf, dass sie sich mehr Programmflächen wünschen. Können Sie das in einer gewissen Weise nachvollziehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie für das ZDF viele Jahre aus London berichtet haben?
Nein, ich kann das nicht nachvollziehen. Die Auslands-Korrespondenten arbeiten doch jetzt schon rund um die Uhr. Wir haben über 50 Prozent Informationsanteil im ZDF, den ganzen Tag gibt es diverse Nachrichtenformate, angefangen vom "Morgenmagazin", bis zum "heute-journal" und " heute nacht". Dazu Dokumentationen und das "Auslandsjournal". Und mit "heute in Europa" hat das ZDF die einzige tägliche Europanachrichten-Sendung. Dazu die neuen Medien. Die Kollegen können gar nicht so viel produzieren wie wir Programme haben. Und das Interesse an Auslandsberichterstattung wächst weiter, wir erleben doch alle immer deutlicher, dass außen oftmals auch innen ist. Viele Themen der jüngsten Zeit, wie die Euro-Krise oder die Atomkatastrophe von Fukushima, sind auch von innenpolitischer Bedeutung. Fukushima hat immerhin die Landtagswahl in Baden-Württemberg mit entschieden.
Da gibt's gar keinen Platz mehr für die schönen Bilder aus fernen Ländern.
Doch, aber ferne Exotik hat mit Fremdheit zu tun. Und fremd ist uns langjährigen Reiseweltmeistern nicht mehr so viel wie früher. Heute kennen wir die Welt besser - für das "Auslandsjournal" ist das Chance und Herausforderung. Wir können an mehr anknüpfen, müssen aber zugleich mehr bieten als "nur" große, weite Welt.



 von
von