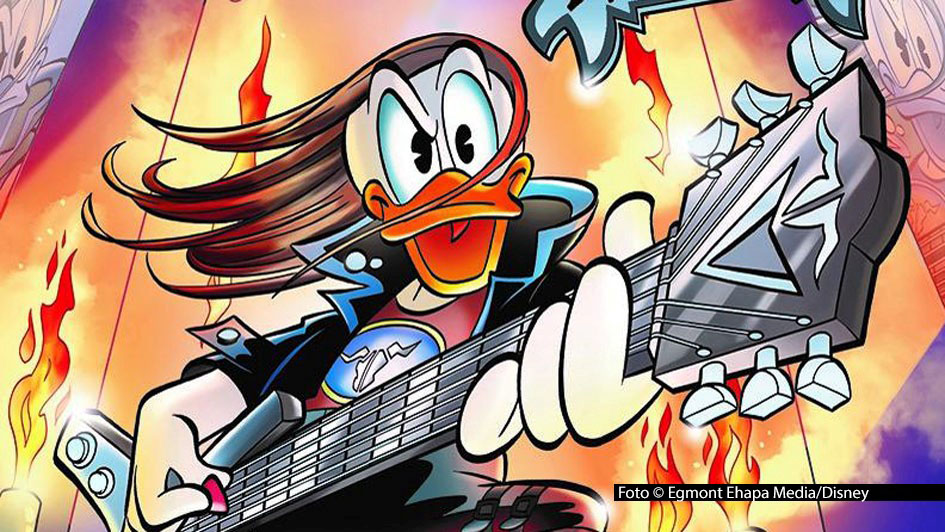© Jerome Latour
© Jerome Latour
Oh, das ist lange her.
Bis Ende der Sechzigerjahre.
Da bin ich mal gespannt, wie unsere Version angesichts heutiger Sehgewohnheiten ankommt. Wobei ich die finale Version noch gar nicht gesehen habe, dafür brauche ich immer ein wenig Abstand. Aber man bekommt ja schon während des Drehens mit, wie es am Bildschirm aussieht. Früher wussten das im Grunde nur die Kameraleute. Heutzutage stehen überall am Set Monitore, wo man bis aufs Colour-Upgrading fast eins-zu-eins sehen kann, ob das Bild funktioniert – oder eben nicht.
Beim Revue-Film im 2. Drittel des 20. Jahrhunderts wurde die Story um Showteile mit den Bühnenstars jener Zeit, herumgestrickt. Ist hier die Geschichte einer DDR-Tänzerin mit unbekannter BRD-Schwester zentraler als die Legende Friedrichstadtpalast.
Inhaltlich stand die Story im Vordergrund. Was den Ausstattungsaufwand betrifft, war es hingegen die Palastbühne. Wobei für mein Team weniger wichtig war, in welchem Zeitraum und politischen System sie aufgebaut wurde, sondern wie man historische Revuestoffe in zeitgemäße Unterhaltung übersetzt: Die Interaktion zwischen Kulisse, Lichtdesign und Ensemble ist auf Bühnen völlig anders und komplexer als bei Straßen- und Studioszenen. Inszenierungen innerhalb einer Inszenierung zu choreografieren, ist für sich schon herausfordernd. Das Ganze aber auch noch mit dem unüblichen Stilmittel Musik und Tanz, macht die Challenge für alle noch größer.
Welche Challenge ist das denn, was genau macht ein Szenenbildner?
Plakativ ausgedrückt, hat er die Hoheit über alles Sichtbare, was nicht Schauspiel und Licht ist. Wie es am Ende wirkt, hängt zwar stark von Kamera und Regie ab; aber durch die stimmige Zusammenführung aller visuellen Elemente, erschaffen wir ein atmosphärisches Gesamtbild – und das ist bei einem Studiobau wie „Der Palast“ natürlich gewaltig.
Besorgen Sie dafür alles Sichtbare auch schon mal selber?
Nein, die Aufgabe des Szenenbildners, heute auch Production Designer genannt, gleicht eher dem des Dirigenten, der das Gesamtwerk im Blick hat, während sich das Orchester auf die eigenen Instrumente konzentriert. Ich nähe nichts mehr selber zusammen, bin aber so eine Art Nadelöhr, durch das am Ende alles hindurchmuss, was im Bild zu sehen ist. Studienabgänger sind heute bisweilen erstaunt, wie groß der organisatorische Teil verglichen mit dem künstlerischen ist. Abgesehen vom Handwerk gehören dazu auch Budgetfragen oder der Umgang mit Menschen. Beides kann man nur bedingt lernen, das hat viel mit Berufserfahrung zu tun.
Die umfasst bei Ihnen mehr als drei Jahrzehnte. 1992 etwa haben Sie eine andere Legende ausgestattet: „Liebling Kreuzberg“.
Verglichen mit Kino und Theater waren Fernsehserien damals zwar noch ein wenig verpönt, aber man hat darin viel Handwerk gelernt, besonders Geschwindigkeit, Präzision. Wobei mir sehr geholfen hat, dass ich seinerzeit von der Hochschule für Bildende Künste am Hamburger Lerchenfeld kam, wo ich freie Kunst und Bühnenbild studiert habe.
Wir statten alle lieber Raumschiffe als Kammerspiele aus.
Danach haben Sie von der Vorabendserie bis zum historischen Mehrteiler wie „Krupp“ und „Das Adlon“ oder den „Club der singenden Metzger“ verschiedenste Genres ausgestattet. Mögen Sie es eher opulent oder dezent?
Wir statten alle lieber Raumschiffe als Kammerspiele aus. Wer wie ich aber von Sandalen- über Ritterfilme bis hin zum Krimi alle Epochen ausstatten durfte, weiß jede einzelne für sich zu schätzen. Das gilt auch für den Revue-Film. Zumal solch ein Auftrag wahrscheinlich einzigartig bleibt.
Stimmt es, was einige Ihrer Kollegen und Kolleginnen behaupten: dass Epochen wie die Achtzigerjahre schwieriger auszustatten sind als das 18. Jahrhundert, weil das Publikum damit persönliche Erinnerungen verbindet und die Authentizität deshalb strenger beurteilt.
Interessantes Thema. Grundsätzlich beeinflusst die Existenz von Zeitzeugen unsere Dreh- und Sehgewohnheiten immens, unter anderem, weil sie eine visuelle Deutungshoheit für sich beanspruchen. Da muss die Ausstattung glaubhaft zwischen plakativer Zuschauererwartung und Realismus balancieren.
Aber im Zweifel statten Sie doch eher Publikumserwartungen als Geschichte aus, oder?
Es soll jedenfalls authentisch, aber auch gut aussehen. Und das ist schon deshalb gar nicht so einfach, weil sich die Leute lieber an Farben erinnern als an Grautöne.
Also: sah es im Friedrichstadtpalast, einem der meistgefilmten Orte der DDR, aus wie in Ihrem Mehrteiler?
Nein.
Nein?!
Nein (lacht). Davon abgesehen, dass wir nur teilweise darin gedreht haben, kann man heutzutage weder die Kulissen noch die Shows geschweige denn viele der Räumlichkeiten abseits der Bühne filmisch 1:1 übernehmen. Dank des fabelhaften Palast-Archivs konnten wir zwar gut recherchieren, aber um die engen Flure hinterm Saal zeitgemäß interessant zu machen, war eine Art neuerfundener Realität mit etwas Übertreibung nötig.
Lassen Sie dabei auch eigene Erfahrungen einer Zeit in die Arbeit an einer Epoche fließen, die Sie als Ausstatter noch persönlich erlebt haben?
Die Zeit des Mauerfalls war jedenfalls dadurch geprägt, dass wir direkt danach in Ostdeutschland gedreht haben und auf der Suche nach Material und Sets weiter als nur in den damaligen Alltag vorgedrungen sind. Einen interessanteren Abenteuerspielplatz konnte man sich als Szenenbildern seinerzeit kaum wünschen.
Dank digitaler Tools kann man sich heutzutage Welten erschließen, die zuvor undenkbar waren. Von Entzauberung keine Spur.
Ist es teurer, diese Zeit auszustatten als unsere?
Geld spielt immer eine Rolle, und es reicht nie. Aber die Constantin hat uns ein gutes Gerüst zur Verfügung gestellt, und ich hoffe, man sieht es der Serie auch an. Wobei man wissen muss, dass osteuropäische Altstädte wie Breslau, wo wir gedreht haben, zwar bessere Annäherungen an die Zeitepoche liefern als deutsche; die Zeit ist aber auch dort nicht stehengeblieben. Außendrehs sind überall aufwändig, und ohne analoge Bauten zuzüglich digitaler Retusche undenkbar.
Was war da die größte Herausforderung bei „Der Palast“.
Abgesehen von der allgegenwärtigen Corona-Problematik die Ausstattung der Shows – inhaltlich, technisch, aber auch zeitlich, um den alltäglichen Betrieb dort so wenig wie möglich zu stören. Aber auch, weil der Friedrichstadtpalast damals eine riesige Baustelle war. Die gesamte Lichttechnik musste neu installiert werden.
Die Massenszenen auf der Bühne sind aber alles echte Menschen?
Auf der Bühne war alles analog, nur das Publikum wurde digital vervielfältigt.
Ist diese Digitalisierung aus Sicht des handwerklich ausgebildeten Ausstatters eigentlich eine Erleichterung oder womöglich eine Entzauberung.
Mehr noch: Es ist sogar eine Bereicherung. Dank digitaler Tools kann man sich heutzutage Welten erschließen, die zuvor undenkbar waren. Von Entzauberung keine Spur.



 von
von