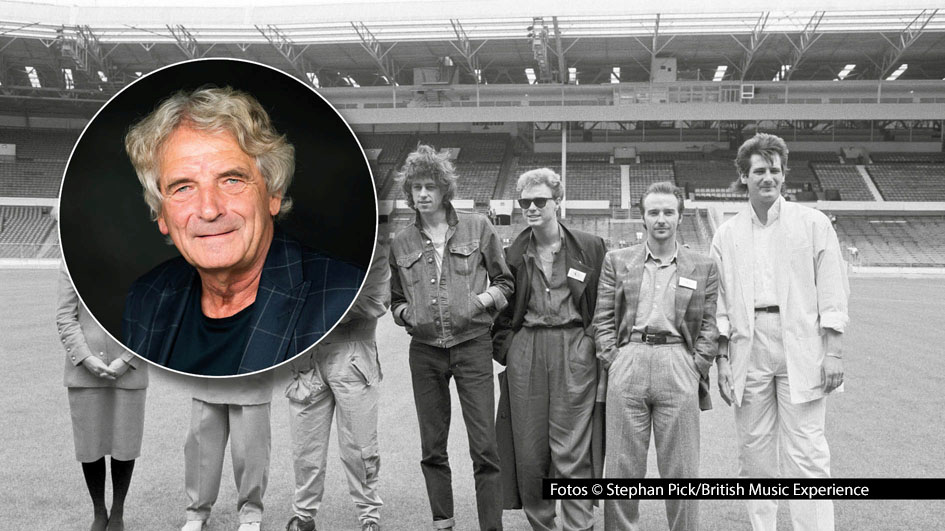Am Bildschirm hat die Hochkultur gemeinhin drei Lieblingsgegner, in die es ihre feuilletonistischen Fangzähne mit besonders großer Freude schlägt: Traumschiff, Pilcher und historische Mehrteiler. Wenn alle drei Formate nun gemeinsam durchs Flachwasser üppig ausgestatteter Romantik schippern, könnte die anspruchsvolle Fernsehkritik also kaum herzhafter zubeißen als bei der Netflix-Serie „Bridgerton“. Schon zum Auftakt des Achtteilers scheint Käpt‘n Silbereisen ja in Zylinder und Frack an der Küste Cornwalls vor 200 Jahren festzumachen.
Wir schreiben die kurze Ära der „Regency“ – ein ebenso rückständiges wie fortschrittliches Zeitalter. Während Englands Agrargesellschaft mit revolutionärer Wucht zur Industriegesellschaft wächst und dabei alle sozialen, kulturellen, politischen Fundamente durchschüttelt, tut Londons High Society so, als sei ihre Welt davon nicht berührt. Herkunftsstolz flanieren Edelleute über den Grosvenor Square, wo Töchter aus gutem Hause für Söhne aus besserem zugerichtet werden. „Meine Hüfte war in Prudences Alter breit wie anderthalb Orangen“, treibt Lady Featherington die Zofe an, das Korsett ihrer Ältesten enger zu ziehen, derweil sich auch die sechs geschlechtsreifen Kinder der Witwe Bridgerton für den Hochzeitsmarkt fertig machen.
Das Jahr 1813, so lernen wir schon in den ersten fünf Minuten der zuckrigen Kostümserie, ist zumindest in Adelskreisen von der rauen Wirklichkeit noch weiter entfernt als Florians Traumschiffführer, Rosamundes Landschaftsmalerei oder Guido Knopps Opfervolkmythos. Hinter den Mauern prachtvoller Stadtpaläste geht es nämlich ums Heiraten, sonst nichts. Von der ersten bis zur 480. Minute wird demnach gebalzt und gefreit, geliebt und gelästert, gefreit und gestritten, dass die Pressdekolletees nur so platzen. Folge für Folge. Welch ein gefundenes Fressen für bissige TV-Kritiker. Sofern sie nur der Nase nachgehen.
Empfohlener externer Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Je tiefer man jedoch in die Zutatenliste der Serie vordringt, desto reichhaltiger wird Chris van Dusens Menü. Dem Showrunner gelingt es nämlich, hinter der Fassade herrschaftlicher Prachtbauten ein Wachsfigurenkabinett der Ständegesellschaft aufzustellen, dass über unsere Gegenwart fast noch mehr aussagt als über die Vergangenheit der englischen Oberschicht. Dafür bedient er sich einer Lady Whistledown, die das Kuppelgeschehen nicht nur mit der Stimme von Julie Andrews aus dem Off kommentiert. Nebenbei füttert ihr flächendeckend verschlungener „Society Report“ die dekadente Upper Class mit Klatsch und Tratsch, der auch die Yellow Press von heute kennzeichnet.
Auch 200 Jahre später würde der Pakt, den die zauberhafte Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) mit dem stattlichen Duke of Hastings (Regé-Jean Page) knüpft, ja alle Regenbogentitel füllen. Erstere galt schließlich als beste Partie der oberen Zehntausend, fiel dank Lady Whistledowns Gerüchteküche jedoch in Ungnade der aristokratischen Männerwelt. Letzterer wurde von seinem Vater so schlecht behandelt, dass er ihm am Sterbebett geschworen hatte, keine Erben zu zeugen, obwohl ihn die Damenwelt Londons kollektiv anhimmelt.
Die Serie sprengt historische Grenzen
Um gemeinsam dem Schwitzkasten der Konventionen zu entkommen, täuscht Daphne eine Liaison mit Hastings vor, um ihn von der Liste begehrter Junggesellen zu streichen und zugleich den Jagdinstinkt seiner Konkurrenz zu wecken. Dass sich beide im Laufe ihrer Fake-Liaison näherkommen, ist da kaum zu vermeiden. Aber aber darum geht es nur im Zentrum der Erzählung. Ringsherum entlarvt sie ein System wechselseitiger Selbstvermarktung, das bewusst an Jahrmärkte der Eitelkeiten im Zeitalter von Social Media erinnert. Obwohl die nachkolorierte Hochglanzproduktion von Shonda Rhimes („Grey’s Antomy“) in einer Epoche brutaler Umwälzungen praktisch ohne Hunger, Elend, Proletariat auskommt, obwohl sie von der Farbgebung bis hin zur Dialogregie das Bild fortwährender Sorglosigkeit suggeriert, darf man „Bridgerton“ daher als nostalgischen Kommentar auf die Oberflächlichkeit der Generation Instagram lesen.
Eine Deutungsmöglichkeit übrigens, die durch den bizarren Dreh der Adaption von Julia Quinns gleichnamigem Bestseller noch nahliegender wird: Diverse Charaktere, Lord Hastings inklusive, sind nämlich People of Colour, die in der rassistischen Plateauphase des British Empire eigentlich den Dreck der weißen Oberschicht beseitigt haben, aber gewiss nicht auf denselben Bällen getanzt. Weil deren Soundtrack zudem aus modernen Popsongs – etwa „Girls Like You“ von Maroon 5 – im Gewand klassischer Musik besteht und die Frauen trotz aller Misogynie von frühfeministischer Schlagkraft sind, sprengt „Bridgerton“ auch sonst historische Grenzen.
Während die öffentlich-rechtliche Schmalzfabrik Degeto – nicht mehr so schlimm wie früher, aber schon noch hochdosiert – reihenweise Süßstoff fürs Herz herstellt, liefert Netflix hier also serienweise Süßstoff fürs Hirn. Auch der verklebt bei übertriebenem Genuss schnell die Synapsen, ist aber ungleich bekömmlicher als jeder ARD-Freitagsfilm. Und ganz nebenbei selbst in der synchronisierten Fassung einigermaßen genießbar.
"Bridgerton", ab sofort bei Netflix



 TV-Kritik von
TV-Kritik von