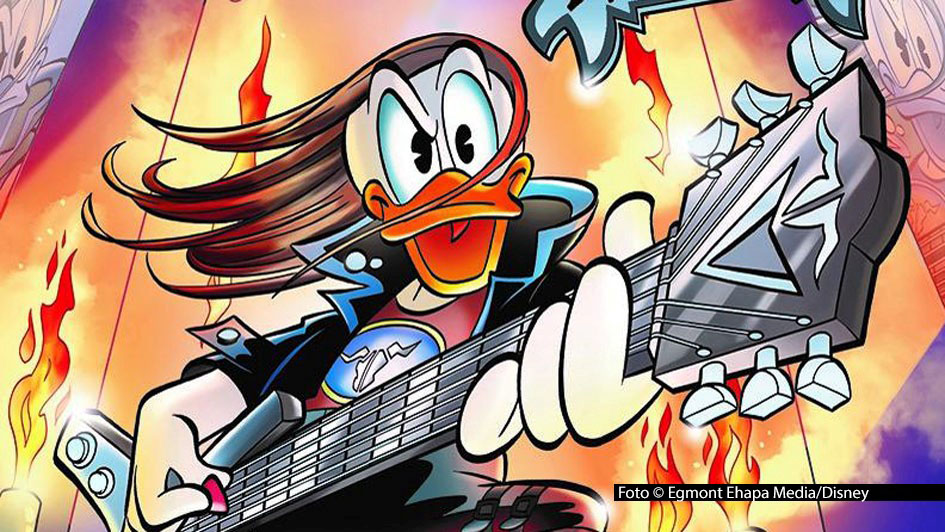Einheitsfeiertage sind oft Selbstbeweihräucherungstage. Deutschlands dunkle Vergangenheit macht daraus zwar schon auch mal Selbstreflexionstage, an denen nicht nur gejubelt, sondern gemahnt werden darf; wer am heutigen Tag reflektierter Selbstbeweihräucherungseinheit „Capital B“ sieht, könnte dagegen glatt denken, der 3. Oktober 1990 habe die geteilte Nation endgültig entzweit. Und das macht dank Florian Opitz‘ famoser Recherche auf Arte fünfmal rund 50 Minuten fassungslos, wütend – und ein bisschen müde.
Am 9. November 1989, das legt sie nach der üblichen Mauerfall-Euphorie nahe, standen dieser eingesperrten Stadt buchstäblich alle Türen offen. Durch Berlin pfiff ja nicht nur der weltpolitische Wind of Change; auch das Gesellschaftsmodell bog sich im Sturm dieser umwerfenden Epoche. Oder wie es deren Zeitzeuge Alexander Sandy Kaltenborn ausdrückt: „Das war schon so’n Gefühl, von uns gehört die Stadt.“
Ein Gefühl, das Opitz mit reichlich Archivmaterial einer kurzen Phase der Anarchie belebt – und wieder tötet. Denn während damalige Hausbesetzer wie Kaltenbach, damalige Lokalpolitikerinnen wie Renate Künast, damalige Clubgründer wie Dimitri Hegemann, damalige Partyqueens wie Danielle de Picciotto die Wende in Rückblicken und Aussagen wörtlich nehmen, zersägt der Regisseur ihre Hoffnungen auf weniger warenförmige, selbstverwaltet emanzipierte Lebensmittelpunkte im Gegenschnitt konservativer Beharrungskräfte. Allen voran Eberhard Diepgen und Klaus-Rüdiger Landowsky.
Kein Jahr vorm Mauerfall auf die Oppositionsbank befördert, wird der Christdemokrat ein Jahr drauf im patriotischen Sog der Bundestagswahl erneut regierender Bürgermeister und macht den Banker zum Fraktionschef. „In den nächsten fünf Jahren entscheidet sich, welche Rolle Berlin die nächsten Jahrzehnte spielt“, unkt er Ende 1990, was sein Parteifreund Diepgen 32 Jahre nach der großen Koalition mit dem wesensverwandten SPD-Vize Walter Momper so präzisiert: „Hauptstadt ist etwas, wo auch wirtschaftliche Macht beheimatet ist.“
Garniert mit Kapiteltiteln von „Sommer der Anarchie“ über „Größenwahn“ und „Absturz“ bis „Stadt als Beute“, rührt Florian Opitz daraufhin gewissenhaft im Schmelztiegel unversöhnlicher Gegensätze: Hier junge Subkulturen, die auf den Brachen rechtsfreier Räume Party-, Kunst- und Lebensbiotope von alternativer Vielfalt eröffnen. Dort alte Machtstrukturen, die das als Bedrohung von Law & Order darstellen und mithilfe finanzkräftiger Konzerne im Keim ersticken.
Hier Marion Brasch, anno ’91 Moderatorin des ostdeutschen Jugendradios DT64, die drei Jahrzehnte später optisch (nicht geistig) ergraut „wir haben uns nicht hingestellt und gesagt, wir wissen Bescheid, sondern wir wissen genauso wenig wie ihr“ einräumt. Dort Roland Ernst, milliardenschwerer Baulöwe, der den Kauf zentraler Filetstücke zum Treuhand-Freundschaftspreis mit „wir waren alle überzeugt: Die Unternehmen, die Politiker, die Banker“ kommentiert.
Hier Basis, dort Überbau. Hier Alltag, dort Kapital. Hier Aufbruch, dort Abbruch. Hier Genossenschaften, dort Bodenspekulationen. Hier angeblich legitime Aneignung, dort angeblich legale Enteignung. Hier Räumungen besetzter Altbaublöcke wie jene der Mainzer Straße, die Beteiligte als Bürgerkrieg schildern. Dort Briefbomben für den Baubeamten Hanno Klein, der die City mit dem „Staubsauger“ von „Störfaktoren“, vulgo: „Menschen“ seiner Vision der Wirtschaftsmetropole säubern wollte und wohl dafür ermordet wurde.
Es ist eine ebenso kurze wie folgenschwere Zeit wechselseitiger Dämonisierungen, die Opitz – für seine Doku globaler Privatisierung („Der große Ausverkauf“) 2009 preisgekrönt – von Annette Muff und Nadja Werner zur Werkschau neofeudaler Biotope montieren lässt. Damit geht „Capital B“ ein Stück weit über öffentlich-rechtliche Milieustudien wie „Technohouse Deutschland“ oder unlängst „Exzess Berlin“ hinaus, die das subversive Potenzial der frühen Wendejahre eher im Mikrokosmos beschreiben.
Der Makrokosmos dieses Arte-Meisterwerks hingegen gipfelt nicht nur dem Untertitel nach in der Eigentumsfrage „Wem gehört Berlin?“. Unausgesprochen folgt darauf jene, wem alles andere gehört: der Staat, das Gemeinwesen, die Demokratie. Antworten gibt Opitz – obwohl seine Sympathie für die Besitz- und Einflusslosen unüberhörbar ist – zum Glück keine. Umso mehr aber trägt „Capital B“ zum Verständnis einer Gesellschaft bei, deren Immobilienkrise auch alle anderen mit Energie-, Mobilität-, Klima- davor betrifft.
Weil Krisen komplex sind, kriegt allerdings nicht nur die machtbewusste CDU ihr Fett weg. Nachdem sie – ob Industrialisierung, Potsdamer Platz, Olympiabewerbung oder die steuerfinanzierte Bankgesellschaft Berlin – praktisch jedes Großprojekt gegen die Wand gefahren hat, übernimmt 2001 Klaus Wowereit das Steuerrad einer komplett kaputtexpandierten Kommune. Und der tanzt zwar deutlich lässiger als sein Vorgänger, macht aber baugleiche Fehler, namentlich: Thilo Sarrazin.
Als Finanzsenator lässt er die Abrissbirne von den Baseballschlägerjahren der Neunziger durchs „Arm, aber sexy!“- und Aggro-Berlin in eine Gegenwart entvölkerter Cityquartiere und verarmter Randbezirke schwingen – mit fatalen Folgen für Stadt und Mensch. Wie Opitz‘ Kamingespräche mit dem rechtspopulistischen Sozi zeigen, ist der jedoch vor allem eins: vorbehaltlos überzeugt von der eigenen Brillanz. Für die Diepgens, Landowskys, Wowereits und Sarrazins sind Einheitstage halt Selbstbeweihräucherungstage statt Selbstreflexionstage. Das anzusehen macht manchmal wütend. Aber versprochen: es ist eine gute Wut.
Die fünfteilige Dokuserie "Capital B" läuft am 3. und 4. Oktober jeweils ab 20:15 Uhr bei Arte. Online stehen alle Folgen bereits zum Abruf bereit.



 TV-Kritik von
TV-Kritik von