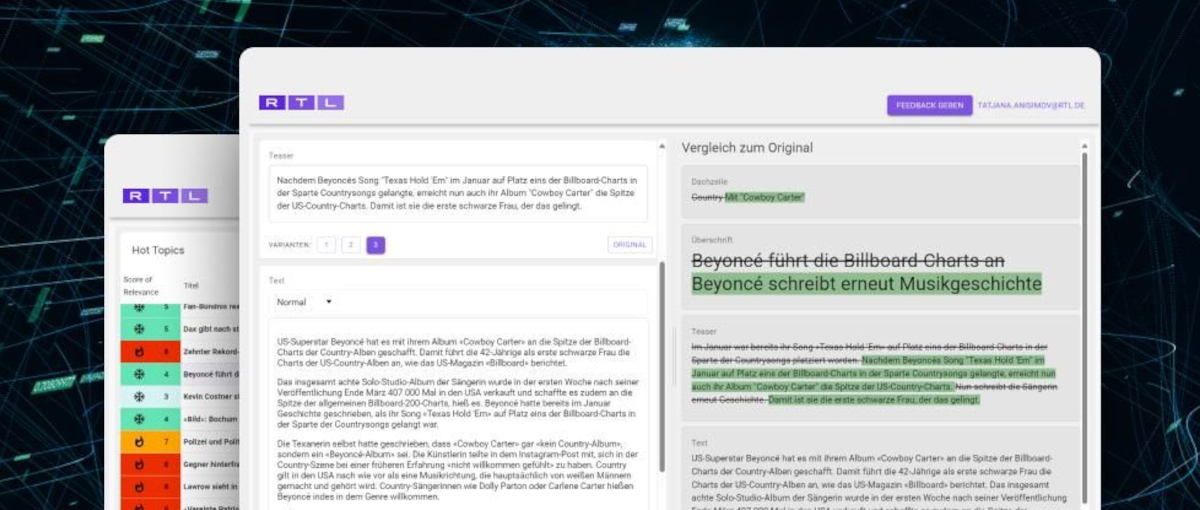Herr Roeder, auf einer Skala von 1 bis 10: Wie froh sind Sie angesichts der jüngsten Diskussion um Songtexte und Gesinnung, dass Xavier Naidoo nicht mehr bei „Sing meinen Song“ dabei ist?
Ich hätte mich gefreut, wenn Xavier weitergemacht hätte. Aber das Leben ist kein Konjunktiv. Seine Entscheidung, aus „Sing meinen Song“ auszusteigen, ist ja nun auch schon ein Jahr her. Für mich war eher die Frage: Wie läuft es mit neuen Hosts, nachdem Xavier das Format drei Jahre lang so stark geprägt hat? Und darüber, dass es so gut funktioniert, bin ich natürlich sehr froh.
Worin sehen Sie das Erfolgsgeheimnis des Formats?
Als Fernsehmacher stellen wir zwar ein Arrangement her, nehmen uns dabei aber so weit zurück, dass die Kunstform Musik Raum zum Aufblühen bekommt. Meist ist ja Musik im Fernsehen gleichbedeutend mit Pause, Umbau, Überbrückung. Hier ist es aber ein bisschen so, als würde man allein unter Kopfhörern seiner Musik lauschen. Durch die Zurückhaltung in der Ausführung und das Vertrauen gegenüber den Musikern entstehen Tiefe und Emotion. Wir gehen nicht ständig rein, wir zerschneiden keinen Auftritt. Außerdem ist es natürlich auch ein Spiel mit den Erwartungen: Kann der das? Wie klingt das? Passen die Künstler zusammen? Für mich kommt dazu, dass die Kollegen von Vox kongeniale Partner sind, mit denen man immer fein was Neues ausprobieren kann.
Wie viel geeignetes Personal für weitere Staffeln gibt es in der deutschen Musikszene noch?
Da bin ich unbesorgt. Das Interesse seitens der Künstler ist sehr groß. Wir denken jetzt schon über die Besetzung fürs nächste Jahr nach. Die einzige Einschränkung ist, dass es im Popbereich deutlich mehr bekannte Männer als Frauen gibt.
Wie wichtig ist die Bekanntheit denn für „Sing meinen Song“? Die aktuelle Staffel hat ja die bislang wohl mainstreamigste Besetzung. Es gibt keinen Daniel Wirtz, den man in der Show entdecken könnte.
Ich habe irgendwo gelesen, dass sich Leute fragen, wo der unbekannte Künstler in dieser Staffel sei. Das ist aber nicht Bestandteil des Formats. Wichtig ist, dass es Überraschungspotenzial gibt. Populäre Künstler haben ja ihr jeweils eigenes Publikum und können vom Publikum der anderen neu entdeckt werden. Nur wenn der Zuschauer die Menschen im Cast und ein paar ihrer Hits kennt, kann er die Fallhöhe der Interpretationen für sich selbst abprüfen.
Mehr als die Hälfte der aktuellen Besetzung hat schon in Ihren Produktionen „The Voice“ oder „The Voice Kids“ mitgewirkt. Hat Talpa Germany es geschafft, ein eigenes Musik-Ökosystem aufzubauen, das senderübergreifend funktioniert?
So denken wir nicht. Wir sind kein musikalisches Ökosystem, sondern besetzen jede Sendung nach ihren eigenen Parametern. Was man allerdings sagen kann: Man entwickelt ein besseres Gefühl und Verständnis für einen Künstler, wenn man schon einmal mit ihm zusammengearbeitet hat. Weil wir uns tief in die musikalischen Zusammenhänge eingearbeitet haben, geben wir Musikern alle Möglichkeiten, um ihre Authentizität zu bewahren.
Haben Sie Vox denn schon angeboten, nächstes Jahr die Echo-Verleihung zu produzieren, damit es nicht wieder so peinlich wird?
(lacht) Ich äußere mich nicht über Programm von Kollegen. Preisverleihungen sind immer ein schweres Geschäft. Ich war beim Echo und hatte den Eindruck, dass die Künstler sich wieder mit der Veranstaltung versöhnt haben. Das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne.
"Wir sind dabei, uns im Bereich Doku und Factual stärker aufzustellen, weil die Sender da erhöhten Bedarf haben"
Karsten Roeder, Geschäftsführer von Talpa Germany
Auch Talpa Germany hat seit „The Voice“ große Schritte gemacht. Ihr Output ist förmlich explodiert.
Wir haben eine Reihe von Formaten, auf die wir stolz sind und die wir gern produzieren. Aber das Produktionsgeschäft ist nicht so, dass man irgendwann auf Autopilot schalten kann. Selbst wenn manche Programme seit mehreren Jahren laufen, muss man sich jedes Jahr aufs Neue die nächsten Schritte überlegen. Gerade sind wir dabei, uns im Bereich Doku und Factual stärker aufzustellen, weil die Sender da erhöhten Bedarf haben, insbesondere für ihre Daytime-Line-ups.
Wie stark können Sie sich auf den internationalen Talpa-Katalog verlassen?
Das Wachstum von Talpa Germany über die vergangenen Jahre hat natürlich viel damit zu tun, dass wir exklusiven Zugang zum Talpa-Katalog haben. Wir greifen auch bei anderen Lizenzgebern zu, wenn wir Perlen wie „Sing meinen Song“ oder „Jerks“ entdecken. Aber der Talpa-Katalog ist der innere Kern unserer DNA und unseres Wachstums. Das wird auch so bleiben.
Das garantiert nicht immer Erfolg. „The Story of my Life“ oder „It takes 2“ sind in Deutschland gefloppt.
Kein Formatkatalog dieser Welt bietet 100 Prozent Erfolgsgarantie. Flops gehören zu unserem Geschäft dazu, sie sind etwas völlig Normales. „The Story of my Life“ mag ich persönlich noch immer sehr gern und bedauere es, dass wir mit dem Programm nicht die Zuschauer gefunden haben, die es aus meiner Sicht verdient hätte. Das war ein kleines, feines Kammerspiel, das sich intensiv mit dem Älterwerden beschäftigt hat. Vielleicht vermeidet es eine Mehrheit der Zuschauer lieber, darüber nachzudenken.
Wenn im Fernsehen um die Wette gesungen oder getanzt wird, ist das ein eng besetzter Wettbewerb. Mit „It takes 2“ haben Sie sich nicht durchgesetzt, mit „The Voice“ dafür umso besser, und auch „Dance Dance Dance“ geht im Herbst bei RTL in die zweite Staffel. Was braucht es denn, um sich als zweites oder drittes Format eines Genres durchzusetzen?
Man muss sich vor allem etwas trauen und deutlich anders daherkommen als mögliche Referenzen, die der Zuschauer im Kopf hat. Ich bin kein Freund davon, ewig lange zu theoretisieren, ob für ein bestimmtes neues Format noch Platz im Markt ist oder nicht. Man muss es einfach nach bestem Wissen und Gewissen ausprobieren.
Mit der Fortsetzung von „Jerks“ für Maxdome und ProSieben sowie mit den beiden neuen RTL-Serien „Jenny“ und „Bad Cop“ hat auch Ihr junger Firmenableger Talpa Germany Fiction gut zu tun. Wo liegt da Ihr strategisches Ziel für die nächsten Jahre?
In der deutschen Fiction herrscht allgemeine Aufbruchsstimmung und es freut uns, dass wir mit ein paar Projekten dabei sind. Das strategische Ziel ist, dass wir in fünf Jahren immer noch Fiction produzieren und in der Branche dann auch wirklich als Fiction-Produzent akzeptiert sind. Wir fangen ja gerade erst an. Mein Kollege Carsten Kelber verantwortet das Fiction-Geschäft. Mir war wichtig, dass wir uns mit Leuten zusammentun, die Ahnung haben. Als Entertainment-Produzent hat man ja doch eine andere Ausrichtung. Wir haben Carsten kennengelernt, als wir 2013/14 „Männer – Alles auf Anfang“ für RTL produziert haben. Hätten wir damals unsere Fiction-Ambitionen eingestellt, dann wäre es ja auch schade um all die neugewonnenen Erfahrungen gewesen. Ich glaube, eine Erfahrung zahlt sich erst dann aus, wenn man es wieder und wieder probiert.
Sehen Sie die Gewichtung zwischen Format-Adaptionen und lokalen Eigenentwicklungen in der Fiction anders als im Entertainment?
Ja, eindeutig. Es ist nicht so einfach, internationale Produktionen in den deutschen Markt zu übertragen. Man kann natürlich Glück haben wie mit der dänischen Vorlage von „Jerks“. Aber grundsätzlich liegt die Besonderheit der deutschen Fiction darin, dass sie nah am Zuschauer ist, so dass der sich wiedererkennt. Deshalb geht es in erster Linie darum, aus der hiesigen Stimmung und aus der Kenntnis des Marktes heraus neue Stoffe selbst zu entwickeln.
Wollen Sie dabei nach Maxdome auch weitere Streaming-Anbieter als Kunden erschließen?
Wer sich ein neues Geschäftsfeld erarbeitet, so wie wir es mit der Fiction tun, der muss Geduld haben. Man kann nicht gleich auf breiter Front vorangehen, weil man Kunden und deren Bedürfnisse erst kennenlernen muss. Deshalb ziehe ich es vor, mit unseren bisherigen Kunden an den aktuellen Projekten zu arbeiten. Natürlich ist es toll, dass die Zahl der potenziellen Abnehmer steigt. Aber wir machen einen Schritt nach dem anderen.
Herr Roeder, herzlichen Dank für das Gespräch.



 von
von